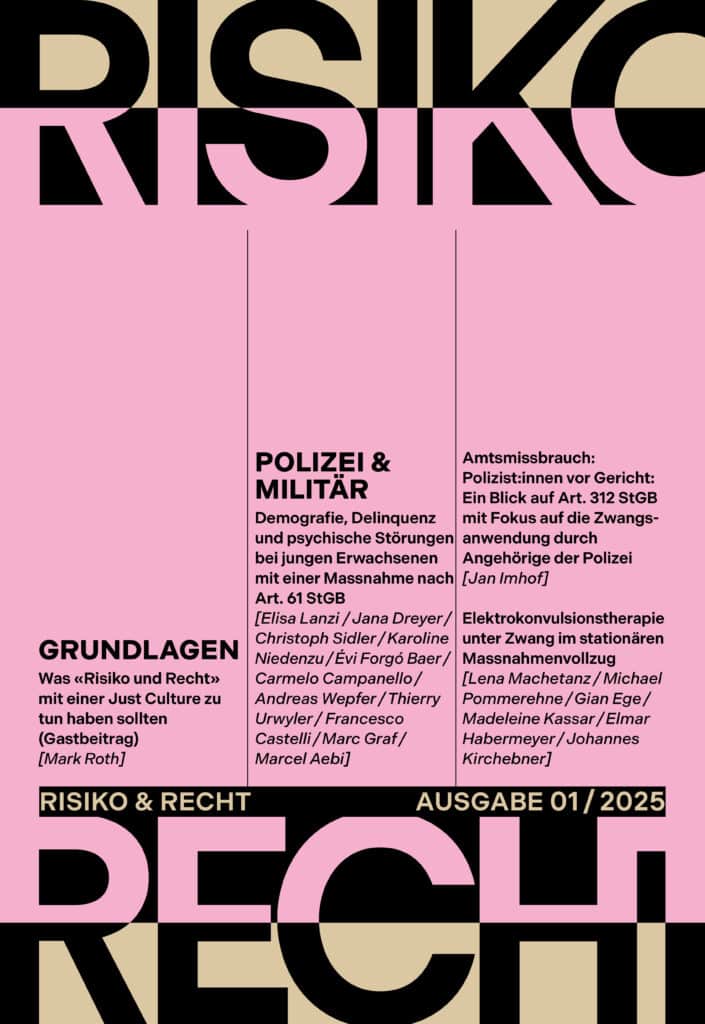Inhalt
I. Einleitung
Das Jugend- bzw. junge Erwachsenenalter ist das Alterssegment mit der höchsten Kriminalitätsbelastung.[1]Odgers et al., 673 ff.; Rocque/Posick/Hoyle, 1 ff. Gleichzeitig besteht aufgrund des noch nicht abgeschlossenen Prozesses des Erwachsenwerdens noch grosses Entwicklungspotential. Im Jugend- bzw. jungen Erwachsenenalter ansetzende Massnahmen können daher einen effektiveren[2]Endrass/Rossegger/Kuhn, 77 ff.; Lipsey/Cullen, 314. Beitrag zur Verhinderung schwerwiegender Delikte leisten, als dies bei älteren Personengruppen der Fall ist.[3]De Tribolet-Hardy/Lehner/Habermeyer, 169. Die Massnahme für junge Erwachsene nach Art. 61 StGB ist auf die besonderen Bedürfnisse dieses Transitionsalters ausgerichtet.[4]Seit der letzten umfassenden Revision des schweizerischen Massnahmenrechts im Jahr 2007 ist die Massnahme für junge Erwachsene nach Art. 61 StGB in der aktuellen Form ein fester Bestandteil des … Continue reading Ihre Anordnung setzt voraus, dass die verurteilte Person zum Tatzeitpunkt zwischen 18 und 25 Jahre alt ist und in ihrer «Persönlichkeitsentwicklung erheblich gestört» ist. Weiter müssen die Taten im kausalen Zusammenhang mit der Persönlichkeitsentwicklungsstörung stehen und durch die Massnahme muss der Gefahr weiterer Delikte begegnet werden können. Sind diese Voraussetzungen erfüllt und erweist sich eine Massnahme als verhältnismässig (Art. 56 Abs. 2 StGB), kann das Gericht die straffällige Person in eine Einrichtung für junge Erwachsene einweisen.
1. Der Prozess des Erwachsenenwerdens
Havighurst formulierte in den 1950er Jahren das Konzept der «Entwicklungsaufgaben».[5]Havighurst, 215. Er bezeichnet damit soziale und biologische Anforderungen, welche in einem bestimmten Lebensabschnitt jedes Individuums (Kindheit, Jugend, Erwachsenenalter und höherem Alter) entstehen und deren erfolgreiche Bewältigung bzw. deren Misslingen sich auf das psychische Erleben sowie auf das zukünftige Verhalten auswirken. Mit seinen besonders vielen Entwicklungsaufgaben wird das Jugendalter als eine kritische Lebensphase angesehen: Typischerweise muss man eine gesunde Einstellung zu sich selbst und zur eigenen kulturellen Identität entwickeln sowie Beziehungen zu anderen Menschen unterschiedlicher Kulturen und Geschlechter aufbauen.[6]Manning, 75. Werden diese Entwicklungsaufgaben nicht oder nur teilweise erfolgreich gelöst, besteht ein erhöhtes Risiko für abweichendes Sozialverhalten. Obwohl Reifungs- und Lernprozesse normative Verläufe aufweisen, können sich allgemein und insbesondere im Jugendalter deutliche Unterschiede zeigen, da biologische und soziale Einflüsse die Entwicklung beschleunigen oder verlangsamen können.[7]Konrad/Klinger-König, 1 ff. Entwicklungsverläufe in der Adoleszenz sind von Lern- und Sozialisationserfahrungen abhängig und werden durch körperliche und hormonelle Veränderungen und neurobiologische Faktoren beeinflusst. Dank neuer technischer Möglichkeiten in der Bildgebung können heute die neurobiologischen Veränderungen und Umstrukturierungen im Gehirn, welche mit der Transition ins Erwachsenwerden einhergehen, besser identifiziert werden.[8]Dünkel/Geng/Passow, 115 f. Diese Prozesse sind mit erreichter Volljährigkeit nicht abgeschlossen, sondern setzen sich bis ca. zum 25. Lebensjahr fort.[9]Dünkel/Geng/Passow, 116 ff. Zahlreiche wissenschaftliche Studien haben sich mit dem Zusammenhang von Entwicklung im Jugendalter bis ins Erwachsenenalter und dem Auftreten von delinquenten und regelverletzenden Verhaltensweisen beschäftigt. Sie kommen zum Schluss, dass der Entwicklungsphase der Adoleszenz für die Ausübung von kriminellen Verhaltensweisen eine Schlüsselrolle zukommt.[10]Siehe z.B. Blonigen, 89 ff. und Moffitt, 674 ff. Persönlichkeitseigenschaften, psychische Störungen, erlebte Belastungen in der Kindheit und Jugend sowie das familiäre und soziale Umfeld konnten als Risikofaktoren identifiziert werden.[11]Laub/Sampson, 150 ff. Relevante soziale Faktoren wurden bisher u.a. in der Tübinger Jungtäter-Vergleichsstudie untersucht, wobei sich verschiedene «Turning Points» identifizieren liessen, welche zu Abbrüchen von kriminellen Karrieren führten.[12]Stelly/Thomas, 117 ff.
2. Die Reifungsprozesse
Nach Erreichen des 18. Lebensjahrs sind in der Schweiz strafrechtliche Bestimmungen für Jugendliche in der Regel nicht mehr einschlägig und das Erwachsenenstrafrecht wird angewendet. Ein fixes Volljährigkeitsalter trägt zwar zur Rechtssicherheit bei, berücksichtigt aber nicht die unterschiedlichen Arten und Zeitrahmen, in denen Jugendliche und junge Erwachsene reifen.[13]Bryan-Hancock/Casey, 57; Nixon, 8. Die strafrechtliche Mündigkeit hängt nicht nur vom biologischen Alter ab, sondern ergibt sich aus den psychosozialen, emotionalen und kognitiven Fähigkeiten, die sich im Prozess des Erwachsenenwerdens herausbilden.[14]Bryan-Hancock/Casey, 58. Während die kognitive Reifung (Fähigkeit im Denkvermögen und in der Argumentations- und Verständnisfähigkeit) in der Regel spätestens mit 18 Jahren abgeschlossen ist, setzt sich die psychosoziale Reifung (die Aspekte der Identitätsfindung, der Impuls- und Handlungskontrolle sowie der moralischen Urteilsfähigkeit umfasst) bis etwa zum 25. Lebensjahr fort.[15]Steinberg, 55. Die psychosoziale Reife definiert das sozio-emotionale Kompetenzniveau einer Person in einem bestimmten Alter, sowie ihre Anpassungsfähigkeit in der Gesellschaft.[16]Galambos et al., 487. Steinberg und Cauffman schlugen ein Modell mit drei Faktoren für die Beurteilung der psychosozialen Reife vor, von denen angenommen wurde, dass sie sich über die Entwicklung verändern und mit dem Urteilsvermögen und den Fähigkeiten zur Entscheidungsfindung im Zusammenhang stehen.[17]Steinberg/Cauffman, 249 ff. Die drei Faktoren sind «temperance» (die Fähigkeit, Impulse zu kontrollieren, einschliesslich aggressiver Impulse), «perspective» (die Fähigkeit, andere Standpunkte zu berücksichtigen, einschliesslich derjenigen, die längerfristige Konsequenzen berücksichtigen oder die den Standpunkt anderer einnehmen) und «responsibility» (die Fähigkeit, persönliche Verantwortung für das eigene Verhalten zu übernehmen und den Einflüssen anderer zu widerstehen). Durch umfangreiche Untersuchungen an verschiedenen Alterskohorten zeigten sie, dass diese so erfasste psychosoziale Reife sich noch über das 18. Lebensjahr hinaus entwickelt. Weitere Untersuchungen[18]Monahan et al., Antisocial Behavior, 1654 ff.; Monahan et al., Psychosocial (im)maturity, 1093 ff.; Steinberg/Cauffman/Monahan, 1 ff. fanden anhand von longitudinalen Selbstberichtsdaten eine starke Unterstützung für dieses Modell und dessen Beziehung zu kriminellem Verhalten. Die Studien fanden aber auch, dass sich die Reife auch über das Alter von 25 Jahren hinaus noch weiterentwickelt.[19]Monahan et al., Psychosocial (im)maturity, 1093 ff.
3. Die Massnahme für junge Erwachsene
Die Massnahme nach Art. 61 StGB greift in der Schweiz die spezifischen Bedürfnisse von straffälligen Personen auf, die sich noch in einem Übergangsalter befinden. Mittels eines multimodalen Konzepts von sozialpädagogischen, forensisch-psychotherapeutischen, schulischen und beruflichen Interventionen wird ihre soziale Integration gefördert, um weiterer Kriminalität entgegenzuwirken. Der Vollzug erfolgt in vier spezialisierten Massnahmenzentren.[20]Massnahmenzentrum (MZ) Arxhof (Basel-Land), MZ Kalchrain (Kanton Thurgau), Centre éducatif de Pramont (Kanton Wallis) und MZ Uitikon (Kanton Zürich). Die Massnahme findet anfänglich bis hin zur bedingten Entlassung mehrheitlich im geschlossenen Setting statt, wobei mittels eines Stufenkonzepts je nach Entwicklung der jungen straffällig gewordenen Personen sukzessive mehr Freiheiten eingeräumt werden können. Von 2007 bis 2020 ist in der Schweiz die gerichtliche Anordnung dieser Massnahme stetig zurückgegangen.[21]Aebi et al., Massnahmenanordnungen, 37 f. Die geringeren Raten von psychiatrischen Gutachten von jüngeren im Vergleich zu älteren erwachsenen Straftätern, die diagnostische Unsicherheit bei der Beurteilung der Reife, die Unsicherheiten im Umgang mit dem strafrechtlichen Landesverweis und der Ausschluss von Psychologinnen und Psychologen als forensische Sachverständige könnten diesen Rückgang beeinflusst haben.[22]Aebi et al., Psychosocial maturity, 4; Habermeyer et al., 127 ff. Das juristische Eingangskriterium der «erheblichen Störung der Persönlichkeitsentwicklung» für die Massnahme nach Art. 61 StGB wird gesetzlich nicht näher definiert und ist in der Rechtsliteratur mehrheitlich spärlich beleuchtet worden.[23]Urwyler/Sidler/Aebi, 14. Darüber hinaus entspricht die Persönlichkeitsentwicklungsstörung keinem definierten psychiatrischen Störungsbild in den gängigen Klassifikationsmanualen. Somit können sich Sachverständige, welche das Vorliegen einer solchen Störung zu prüfen haben, nicht auf die Kriterien der bekannten psychiatrischen Klassifikationssysteme wie ICD[24]International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems. oder DSM[25]Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. abstützen. Der diagnostische Terminus «Persönlichkeitsentwicklungsstörung» war zu keinem Zeitpunkt ein unangefochtener diagnostischer Standard in der Psychiatrie und der Psychologie und die spezifische Forschung zur Persönlichkeitsentwicklungsstörung ist in der Fachliteratur nur in Ansätzen vorhanden.[26]Adam/Breithaupt-Peters, 47 ff.; Urwyler/Sidler/Aebi, 14. Seit den 50er Jahren wurden zuerst mit den Marburger-Kriterien[27]Urwyler/Sidler/Aebi, 29. dennoch verschiedene Versuche unternommen, Kriterien für Entwicklungsstörungen zu definieren, welche zur Beurteilung von straffällig gewordenen Jugendlichen und jungen Erwachsenen herangezogen werden könnten. Die bestehenden Instrumente orientieren sich meist an den Reifekriterien[28]Pruin, 19. nach § 105 JGG/DE, welche bei 18–21-Jährigen hinzugezogen werden, um zu entscheiden, ob das Jugend- oder Erwachsenenstrafrecht Anwendung findet (bspw. Marburger-Kriterien/ Erweiterung von Villinger von 1955[29]Villinger, 1 ff., Kriterien von Esser von 1992[30]Esser/Fritz/Schmidt, 356 ff., Kriterien der Bonner Delphi-Studie von 2003[31]Busch/Scholz, 421 ff. und 2006[32]Busch, 52., Kriterien von Buch/Köhler von 2019[33]Von Buch/Köhler, 178 ff.). In der Schweiz wurde von Urwyler, Sidler und Aebi davon ausgehend ein konsolidiertes Modell vorgeschlagen.[34]Urwyler/Sidler/Aebi, 75 ff.
4. Fragestellungen und Hypothesen
Seit der Revision des Strafrechts und der Einführung der Massnahme für junge Erwachsene nach Art. 61 StGB im Jahr 2007 wurde keine systematische Erhebung zu den Kriterien der erheblichen Störung der Persönlichkeitsentwicklung sowie zu ihrer Beurteilung in den Indikationsgutachten vorgenommen.
Die vorliegende Studie beschäftigt sich mit der Frage, welche Eigenschaften für Personen mit einer Massnahme nach Art. 61 StGB hinsichtlich Demografie, Delinquenz und gutachterlicher Beurteilung (inklusive psychiatrischer Störung) charakteristisch sind. Als Vergleichsgruppe wurden junge Erwachsene beigezogen, bei denen im Alter zwischen 18–25 Jahren eine ambulante Massnahme nach Art. 63 StGB angeordnet wurde. Anders als bei der stationären Massnahme nach Art. 61 StGB, bei welcher ein Verbrechen oder Vergehen als Straftat vorausgesetzt wird, ist bei der Massnahme nach Art. 63 StGB zumindest vom Gesetzeswortlaut her (vorbehaltlich der Verhältnismässigkeit) jede Straftat eine taugliche Anlasstat.[35]Urwyler et al., Handbuch, 785. Jedoch muss eine schwere psychische Störung oder Abhängigkeit als Eingangsmerkmal vorliegen. Es wurde untersucht, ob bzw. wie sich Personen in Massnahmen nach Art. 61 StGB und 63 StGB in Bezug auf die soziodemografischen Daten, kriminelle Vorbelastung, allfällige frühere Massnahmen sowie in Bezug auf die im Anlassurteil abgeurteilten Straftaten, Strafhöhe, Schuldfähigkeit, Diagnostik und Risikoeinschätzung unterscheiden. Die formale Begutachtungsqualität, die Anwendung von spezifischen Instrumenten für die Beurteilung der Persönlichkeitsreife sowie mögliche Zusammenhänge zu ICD-10[36]Die ICD-10 stellt die zehnte Version der ICD dar. Die ICD-11 trat erst im Jahr 2022 in Kraft. Diagnosen wurden ebenfalls analysiert.
Bezüglich demografischer Merkmale wurde erwartet, dass junge Erwachsene in einer Massnahme nach Art. 61 StGB im Vergleich zu denen in einer Massnahme nach Art. 63 StGB ambulant behandelten aus einem instabileren Familienumfeld[37]Das sogenannte «broken home»: unvollständige Familie, Abwesenheit eines Elternteils als Folge von Ehescheidung, Tod, Getrenntleben oder sonstigen Umständen. stammen und eine geringere Sozialisation mit mehr Schul- und Ausbildungsabbrüchen aufweisen. Auf Basis der rechtlichen Anordnungsvoraussetzungen (namentlich Verhältnismässigkeitsprinzip; Art. 56 Abs. 2 StGB) wurde bei ihnen eine schwerere kriminelle Vorbelastung und häufigere (jugend‑)strafrechtliche Verurteilungen und Massnahmen in der Vorgeschichte erwartet. In Bezug auf die für die aktuelle Massnahme relevanten Anlassdelikte wurde das Vorliegen höherer Freiheitsstrafen und ein höheres Rückfallrisiko bei der gutachterlichen Beurteilung erwartet.
In Bezug auf die diagnostische gutachterliche Beurteilung wurde erwartet, dass Personen mit einer Massnahme nach Art. 61 StGB im Vergleich zu einer Massnahme nach Art. 63 StGB häufiger Persönlichkeitsentwicklungsstörungen, jedoch weniger häufig andere psychische Störungen nach ICD-10 aufweisen würden.
Als weitere explorative Fragestellungen wurden die formale Qualität der Gutachten und die verwendeten Instrumente zur Erhebung von Persönlichkeitsentwicklungsstörungen untersucht.
II. Methode
1. Studienprotokoll und Ethikantrag
Die Stichprobe umfasste junge Erwachsene, bei welchen im Kanton Zürich von 2007 bis 2020 eine Massnahme nach Art. 61 StGB vorsorglich oder rechtskräftig angeordnet wurde. Durch die Analyse der (rechtskräftigen) Urteile wurden Daten zu soziodemografischen Merkmalen, Anlassdelinquenz für die Massnahme, Beurteilung der Schuldfähigkeit sowie jugendstrafrechtlichen Vorgeschichten erhoben. Die Indikationsgutachten wurden in Bezug auf die formale Qualität, auf die gestellten ICD-10-Diagnosen und auf die Beurteilung der Schuldfähigkeit hin analysiert. Es wurde weiter erfasst, mit welchen Instrumenten die Reifebeurteilung vorgenommen wurde, ob eine Reifestörung, ein Entwicklungsrückstand oder eine Persönlichkeitsentwicklungsstörung festgestellt wurde, wie das Rückfallrisiko quantifiziert wurde und welche Massnahmen empfohlen wurden. In Bezug auf die strafrechtliche Vorgeschichte im Jugendalter wurde untersucht, bei wie vielen jungen Erwachsenen ein jugendstrafrechtliches Vorgutachten vorlag sowie ob und mit welchen Instrumenten in diesen eine Reifestörung, ein Entwicklungsrückstand oder eine Persönlichkeitsentwicklungsstörung festgestellt wurde. Als Kontrollgruppe wurden junge Erwachsene im gleichen Altersspektrum verwendet, bei welchen im gleichen Zeitraum im Kanton Zürich eine ambulante Massnahme nach Art. 63 StGB angeordnet wurde. Die zwei Gruppen wurden in Bezug auf die oben genannten Parameter (Demographie, Anlassdelinquenz, psychische Störungen und Reifestörung, bzw. Entwicklungsrückstand und/oder Persönlichkeitsentwicklungsstörung) verglichen. Weiter wurde die formale Qualität der Gutachten und die verwendeten Instrumente zur Beurteilung von Persönlichkeitsentwicklungsstörungen erhoben.
Die Zuständigkeitsprüfung durch die Kantonale Ethikkommission des Kantons Zürich ergab, dass das Forschungsprojekt nicht in den Geltungsbereich des Humanforschungsgesetzes fällt und daher eine Genehmigung der Ethikkommission nicht erforderlich ist.[38]Antrag 2023-00548 von 03. Mai 2023.
2. Stichprobe
Die Identifizierung der relevanten Probanden erfolgte mittels Analyse des Rechtsinformationssystems (RIS) des Kantons Zürich vom 1. Oktober 2021. Es wurden alle Personen erfasst, welche zwischen dem 1. Januar 2007 und dem 31. Dezember 2020 bei den Bewährungs- und Vollzugsdiensten (BVD) des Kantons Zürich eine rechtskräftige oder vorsorgliche Massnahme nach Art. 61 StGB und nach Art. 63 StGB (Kontrollgruppe) durchliefen und welche zum Zeitpunkt des Eintritts in die Massnahme zwischen 18 und 25 Jahre alt waren (Geschäftsjahr 2007-2020, Geburtsjahrgang 1982-2002). Es ergaben sich 257 relevante Fälle, davon 139 mit einer Massnahme nach Art. 61 StGB und 118 mit einer Massnahme nach Art. 63 StGB.
Für die vorliegende Studie wurden folgende Ausschlusskriterien festgelegt: 1) eine vorangehende Massnahme nach Art. 61 StGB (in einem anderen Kanton oder vor einer Massnahme nach Art. 63 StGB), (4 Ausschlüsse); 2) ein fehlendes Anlassurteil bzw. Indikationsgutachten für die Massnahme (5 Ausschlüsse); 3) die Nichtverfügbarkeit der Akte in den BVD Zürich (z.B. aufgrund von Aktenausleihe), (13 Ausschlüsse); 4) keine ersichtliche Massnahme nach Art. 61 StGB oder nach Art. 63 StGB in den Akten (Fehler im RIS), (1 Ausschluss). Insgesamt wurden 23 Probanden aus der Analyse ausgeschlossen. Die endgültige Stichprobe bestand somit aus 234 männlichen jungen Erwachsenen, 126 mit einer Massnahme nach Art. 61 StGB und 108 mit einer Massnahme nach Art. 63 StGB. Das Durchschnittsalter zum Zeitpunkt der Untersuchung war 21.33 Jahre (SD = 1.74 Jahre). Es wurden keine weiblichen jungen Erwachsenen im Zeitraum der Datenerhebung gemeldet.
3. Vorgehen bei der Datenerhebung
Eine systematische Analyse der Daten von den BVD wurde durchgeführt. Die aktenbasierte Datenerhebung erfolgte in der Webeingabemaske in RedCap[39]Harris et al., 95 ff. anhand eines zuvor erstellten Codierungssystems, welches die Definition und Ankerbeispiele der zu erhebenden Variablen umfasste. Es wurden der Strafregisterauszug, das Gerichtsurteil und das forensische Gutachten in die Analysen einbezogen. Basierend auf 10 zufällig ausgewählten Fällen wurde das Codierungsschema getestet und fortlaufend optimiert. Anschliessend wurde eine Interratererhebung von drei beurteilenden Personen basierend auf weiteren 20 zufällig ausgewählten Fällen durchgeführt. Basierend auf der Interrateranalyse wurden Variablen mit ungenügenden Übereinstimmungen aus dem Codierungssystem gestrichen.
4. Operationalisierung der variablen Demografie, Kriminalität und psychiatrische Störungen
Die variablen Alter zum Zeitpunkt des Messbeginns, ausländische Staatsangehörigkeit (keine Schweizer Staatsbürgerschaft) und Familienstand (ledig vs. verheiratet/ geschieden) wurden auf Basis des Strafregisterauszugs kodiert. Der sozioökonomische Status (SES) wurde auf der Grundlage der elterlichen beruflichen Tätigkeit (kodiert anhand des Gutachtens) gemäss den ISCO-08-Leitlinien[40]International Labour Organisation. International Standard Classification of Occupations (ISCO). auf einer Skala von 1 (Führungsposition) bis 9 (ungelernter Arbeiter) kodiert; arbeitslose Elternteile wurden mit 10 kodiert. Niedriger SES wurde gewertet, wenn der SES beider Elternteile mit 9 oder 10 kodiert wurde, oder wenn der SES von einem Elternteil fehlte und der SES des anderen Elternteils mit 9 oder 10 kodiert wurde.
Jede frühere Straftat wurde definiert als «jede frühere Verurteilung nach dem StGB als Jugendlicher oder Erwachsener», und jede frühere Gewalttat einschliesslich körperlicher, verbaler oder sexueller Gewalt nach dem StGB, ebenfalls begangen als Jugendlicher oder Erwachsener.
Aktuelle Straftaten wurden aus gerichtlichen Verurteilungen ermittelt, einschliesslich des Vorliegens von Gewaltdelikten (Verbrechen gegen Leib und Leben, Art. 111–136 StGB), Sexualdelikten (Straftaten gegen die sexuelle Integrität, Art. 187–200 StGB) und Eigentumsdelikten (Straftaten gegen das Eigentum, Art. 137–172 StGB).
Anhand der Gutachten wurden die psychischen Störungen, die zum Zeitpunkt der Anlassdelikte vorlagen, nach ICD-10-Kategorien kodiert: Störung des Substanzkonsums (F1), schizophrene Störung (F2), emotionale Störung (affektive oder neurotische Störungen, F3/F4), Persönlichkeitsstörung (F60-F62), antisoziale Persönlichkeitsstörung (F60.2), Unreife Persönlichkeitsstörung (F60.88), andere psychiatrische Störung (aus F-Diagnosen der ICD-10) und jede psychiatrische Störung nach ICD-10 (irgendeine F-Diagnose). Eine Persönlichkeitsentwicklungsstörung wurde als vorhanden kodiert, wenn im Gutachten eine Reifestörung, ein Entwicklungsrückstand oder eine Persönlichkeitsentwicklungsstörung attestiert wurde. Auf die Persönlichkeitsentwicklung bezogene Begriffe wie «Gefährdung der Persönlichkeitsentwicklung» und «Adoleszenzkrise» wurden ebenfalls mit «ja» kodiert. Wenn nicht explizit auf diese Begriffe Bezug genommen wurde, wurde die Variable als nicht vorhanden kodiert. Die Gesamtrisikoeinschätzung in Bezug auf die Deliktkategorien wurde anhand der im Gutachten verfügbaren Informationen erhoben und auf einer Skala von 1, gering, bis 3, hoch, eingestuft. Die Werte wurden aufgerundet und es wurde ein Mittelwert gebildet.
5. Statistische Analyse
Der Student’s t-Test (für kontinuierliche Variable) und der χ2-Test/ Exakte Fisher-Test (für kategoriale Variablen) wurden verwendet, um demografische Daten, Kriminalität und psychiatrische Störungen zwischen den zwei Stichproben (Art. 61 StGB vs. Art. 63 StGB) zu analysieren. Cohens d (Interpretation > 0,20 kleiner Effekt, > 0,50 mittlerer Effekt und > 0,80 grosser Effekt) und Cohens w (Interpretation > 0,10 kleiner Effekt, > 0,3 mittlerer Effekt, > 0,50 grosser Effekt) wurden als Effektstärke für t-Tests bzw. den χ2-Test/ Exakte Fisher-Test berechnet.[41]Cohen, 1988. Aufgrund der durch das multiple Testen erhöhten Wahrscheinlichkeit für fälschliche Zurückweisungen der Nullhypothese wurden die p-Werte nach dem von Benjamini und Hochberg[42]Benjamini/Hochberg, 289 ff. vorgeschlagenen Verfahren korrigiert.
III. Resultate
1. Zur Demografie
In Tabelle 1 sind die Ergebnisse bezüglich soziodemografischer, schulischer, beruflicher und familiärer Informationen für die Gesamtstichprobe und für die beiden untersuchten Stichproben zu finden. Die gesamte Stichprobe bestand aus männlichen jungen Erwachsenen. Sie waren zu Beginn der Massnahme zwischen 18.46 und 24.97 Jahre alt (m = 21.89 Jahre, SD = 1.62 Jahre). 39.7% hatten eine ausländische Staatsangehörigkeit, 226 (97.0%) waren ledig und 42.2% gehörten einem niedrigen sozialen Status an. Probanden mit einer Massnahme nach Art. 61 StGB waren im Durchschnitt jünger, hatten häufiger eine ausländische Staatsangehörigkeit und erlebten häufiger im Kindes- und Jugendalter eine abweichende Elternsituation[43]Multiaxiales Klassifikationsschema nach ICD-10, Z60.1: Heterogene Spannbreite von Situationen, die sich von der traditionellen Norm der Erziehung durch zwei biologische Eltern unterscheidet und bei … Continue reading (66.1% vs. 46.7%, insgesamt 57.2%), als Probanden in einer Massnahme nach Art. 63 StGB. Probanden mit einer Massnahme nach 61 StGB verfügten seltener über eine abgeschlossene Berufsausbildung (4.8% vs. 25.2%) und hatten mehr Abbrüche der Berufsausbildung hinter sich (65.6% vs. 50.0%). Hingegen liessen sich keine Unterschiede in Bezug auf Schulabschluss (73.8%) oder Wohnsituation vor der Massnahme zwischen den zwei Stichproben feststellen.
Tabelle 1: Soziodemografische, schulische, berufliche und familiäre Informationen
| Variablen | Fehlende Werte (%) | Gesamtstichprobe
(n=234) |
Art. 61 StGB (n=126) | Art. 63 StGB (n=108) |
Test-Statistik1
(df) |
p-Wert
(Effektstärke) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alter bei Massnahmenbeginn (Jahre) (M, SD) | 0 (0,0%) | 21,89 (1,62) | 21,51 (1,57) | 22,33 (1,58) | -3,95 (232) | ,005 (0,518)2 |
| Keine Schweizer Staatsangehörigkeit (n, %) | 0 (0,0%) | 93 (39,7%) | 60 (47,6%) | 33 (30,6%) | 6,38 (1) | ,030 (0,174)3 |
| Zivilstand ledig vs. verheiratet/geschieden (n, %) | 1 (0,4%) | 226 (97,0%) | 123 (97,6%) | 103 (96,3%) | – | ,883 (0,039)3 |
| Wohnt bei Eltern/Verwandten vs. Heim/eigene Wohnung (n, %) | 22 (9,4%) | 116 (54,7%) | 68 (58,1%) | 48 (50,5%) | 0,93 (1) | ,477 (0,076)3 |
| Schulabschluss Oberstufe (n, %) | 13 (5,6%) | 163 (73,8%) | 87 (74,4%) | 76 (73,1%) | 0,00 (1) | 1,000 (0,015)3 |
| Abschluss Berufsausbildung (n, %) | 2 (0,8%) | 33 (14,2%) | 6 (4,8%) | 27 (25,2%) | 18,09 (1) | ,005 (0,292)3 |
| Früherer Abbruch einer Berufsausbildung (n, %) | 6 (2,6%) | 133 (58,3%) | 80 (65,6%) | 53 (50,0%) | 5,037 (1) | ,050 (0,158)3 |
| Elterliche Bezugsperson nicht biol. Eltern/Elternteil (n, %) | 1 (0,4%) | 18 (7,7%) | 10 (8,0%) | 8 (7,4%) | 0,00 (1) | 1,00 (0,011)3 |
| Trennung Eltern vor 18. LJ./Eltern nie zusammengelebt (n, %) | 5 (2,1%) | 131 (57.2%) | 82 (66,1%) | 49 (46,7%) | 8,02 (1) | ,013 (0,196)3 |
| Niedriger sozioökonomischer Status (n, %) | 21 (9,0%) | 92 (43,2%) | 55 (47,4%) | 37 (38,1%) | 1,49 (1) | ,370 (0,093)3 |
2. Zu den Straftatbeständen und zu den Urteilen
Frühere Verurteilungen waren bei der Gesamtstichprobe häufig (85.6%) und statistisch häufiger bei Probanden mit einer Massnahme nach Art. 61 StGB (91.3%) als bei denen mit einer Massnahme nach 63 StGB (78.8%) (siehe Tabelle 2). Es liessen sich keine statistisch relevanten Unterschiede in Bezug auf die früheren Delikte und ihre Typologie, auf die früheren verhängten Freiheitsstrafen (50.4% insgesamt) sowie auf die vorgängigen jugendstrafrechtlichen Massnahmen oder zivilrechtlichen Platzierungen (55.6% insgesamt) feststellen. Frühere Massnahmen nach StGB waren bei beiden Stichproben selten (2.6%).
In Hinblick auf die aktuellen Straftaten wurde ein relevanter Anteil der gesamten Stichprobe wegen Eigentums- (65.5%) und Gewaltdelikten (48.7%) und 9.9% wegen Delikten gegen die sexuelle Integrität verurteilt. Die Probanden mit einer Massnahme nach Art. 61 StGB wiesen statistisch mehr Delikte gegen das Vermögen (73.4% vs. 56.5%, wobei die Effektstärke klein war) und gegen Leib und Leben und weniger gegen die sexuelle Integrität auf als die Kontrollgruppe. Tendenziell war die angeordnete Freiheitsstrafe bei den Probanden mit einer Massnahme nach Art. 61 StGB (38.82 vs. 30.84 Monate), länger. Es ergaben sich keine statistisch relevanten Unterschiede in Bezug auf Geldstrafen und Bussen.
Tabelle 2: Frühere und aktuelle Delikte und Urteile
| Variablen | Fehlende Werte (%) | Gesamtstichprobe
(n=234) |
Art. 61 StGB (n=126) | Art. 63 StGB (n=108) |
Test-Statistik1
(df) |
p-Wert
(Effektstärke) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frühere Verurteilung (n, %) | 0 (0,0%) | 200 (85,6%) | 115 (91,3%) | 85 (78,7%) | 6,42 (1) | ,041 (0,178)3 |
| Früheres Gewaltdelikt (n, %) | 0 (0,0%) | 135 (57,7%) | 76 (60,3%) | 59 (54,6%) | 0,56 (1) | ,489 (0,057)3 |
| Frühere Freiheitsstrafe JStG/StGB (n, %) |
0 (0,0%) | 118 (50,4%) | 67 (53,2%) | 51 (47,2%) | 0,60 (1) | ,489 (0,059)3 |
| Frühere Massnahme nach JStG/ Platzierung ZGB (n, %) | 2 (0,8%) | 129 (55,6%) | 73 (58,4%) | 56 (52,3%) | 0,63 (1) | ,489 (0,061)3 |
| Frühere Massnahme nach StGB (n, %) | 1 (0,4%) | 6 (2,6%) | 4 (3,2%) | 2 (1,9%) | – | ,689 (0,041)3 |
| Indexurteil Delikt gegen Leib und Leben (n, %) | 2 (0,8%) | 113 (48,7%) | 66 (53,2%) | 47 (43,5%) | 1,81 (1) | ,365 (0,097)3 |
| Indexurteil Delikt gegen die sexuelle Integrität (n, %) | 2 (0,8%) | 23 (9,9%) | 9 (7,3%) | 14 (13,0%) | 1,51 (1) | ,365 (0,095)3 |
| Indexurteil Delikt gegen das Vermögen (n, %) | 2 (0,8%) | 152 (65,5%) | 91 (73,4%) | 61 (56,5%) | 6,57 (1) | ,041 (0,177)3 |
| Indexurteil Delikt Schuldfähigkeit vermindert od. aufgehoben (n, %) | 104 (44,4%) | 82 (63,1%) | 39 (57,4%) | 43 (69,4%) | 1,52 (1) | ,365 (0,124)3 |
| Indexurteil Freiheitsstrafe in Monaten (M, SD) | 2 (0,8%) | 35,11 (31,98) | 38,82 (25,92) | 30,84 (37,44) | 1,901 (230) | ,171 (0,251)2 |
| Indexurteil Geldstrafe in Tagessätzen (M, SD) | 2 (0,8%) | 6,84 (30,67) | 5,18 (18,72) | 8,74 (40,26) | -0,88 (230) | .489 (0,116)2 |
| Indexurteil Busse in CHF (M, SD) | 2 (0,8%) | 311,10 (473,80) | 335,32 (464,07) | 283,33 (485,39) | 0,83 (230) | .489 (0,110)2 |
| Indexurteil Massnahme nach Art. 61 StGB (n, %) | 2 (0,8%) | 107 (46,1%) | 107 (86,3%) | 0 (0,0%) | 169,51 (230) | ,008 (0,864)3 |
| Indexurteil Massnahme nach Art. 63 StGB (n, %) | 2 (0,8%) | 112 (48,3%) | 8 (6,5%) | 104 (96,3%) | 183,02 (230) | ,008 (0,897)3 |
| Kat. Indexurteil Andere Massnahme (nach Art. 59 StGB/60 StGB) (n, %) | 2 (0,8%) | 6 (2,6%) | 5 (4,0%) | 1 (0,9%) | – | ,365 (0,097)3 |
3. Zur forensisch-psychiatrischen und psychologischen Beurteilung
Wie in Tabelle 3 aufgeführt waren psychische Störungen nach ICD-10 in der Gesamtstichprobe häufig (91.5%). Die meistvergebenen Diagnosen waren Substanzkonsumstörungen (59.8%) und Persönlichkeitsstörungen (42.3%). Verhaltens- und Aufmerksamkeitsstörungen waren in der Gesamterhebung mit 35.1% repräsentiert. Der einzig statistisch relevante Unterschied zwischen den beiden Stichproben bestand darin, dass bei Probanden in einer Massnahme nach Art. 61 StGB seltener psychotische Störungen diagnostiziert wurden als bei denen in einer Massnahme nach Art. 63 StGB (Tabelle 3). In Hinblick auf die Diagnose Persönlichkeitsentwicklungsstörung (inklusive Reifestörungen und Entwicklungsrückstand) zeigte die Analyse der Daten, dass diese in der vorliegenden Gesamtstichprobe von jungen Erwachsenen sehr häufig vorkommt (78,8%). Fast alle Probanden in der Massnahme nach Art. 61 StGB (92.6%), aber auch eine hohe Anzahl von Probanden in der Massnahme nach Art. 63 StGB (62.0%) wiesen gemäss gutachterlichen Beurteilung eine schwere Persönlichkeitsentwicklungsstörung auf. Der Unterschied erwies sich als signifikant mit einer mittleren Effektstärke.
Was die forensische Beurteilung der Schuldfähigkeit betrifft, wurde bei Probanden mit einer Massnahme nach Art. 61 StGB tendenziell seltener als bei der Kontrollgruppe eine verminderte Einsichtsfähigkeit (2.6% vs. 15.8%) und eine verminderte Steuerungsfähigkeit (57.3% vs. 67.3%) attestiert. Bei der Beurteilung des Rückfallrisikos für Gewalt- und Sexualdelikte ergaben sich keine Unterschiede zwischen den zwei Gruppen. Die Probanden in einer Massnahme nach Art. 61 StGB zeigten aber tendenziell eine ungünstigere Prognose für Vermögensdelikte.
Die Massnahme nach Art. 61 StGB wurde gutachterlich bei 87.3% der Probanden empfohlen, welche sich dann in einer vorsorglichen oder einer definitiv angeordneten Massnahme nach Art. 61 StGB befanden. Bei den restlichen Probanden wurde eine ambulante Massnahme nach Art. 63 StGB (8,7%) oder stationär nach Art. 59 resp. nach Art. 60 StGB (5.6%) empfohlen (Tabelle 4). Lediglich bei zwei Drittel der Probanden der Kontrollgruppe (74.1%) wurde eine Massnahme nach Art. 63 StGB gutachterlich empfohlen. Beim restlichen Drittel wurde eine Massnahme nach Art. 61 StGB (18.5%), nach Art. 59 oder nach Art. 60 StGB (10.2%) empfohlen. Bei 15.1% der Probanden wurde die Massnahme nach Art. 61 StGB vorsorglich angeordnet (häufiger als bei der Kontrollgruppe, bei welcher nur bei 2.8% der Fälle die Massnahme vorsorglich angeordnet wurde).
Tabelle 3: Beurteilung der Persönlichkeitsentwicklung und psychischer Störungen
| Variablen | Fehlende Werte (%) | Gesamtstichprobe
(n=234) |
Art. 61 StGB (n=126) | Art. 63 StGB (n=108) |
Test-Statistik1
(df) |
p-Wert
(Effektstärke) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Störung der Persönlichkeitsentwicklung (n, %) | 12 (5,1%) | 175 (78,8%) | 113 (92,6%) | 62 (62,0%) | 29,07 (1) | ,002 (0,373)3 |
| Irgendeine psychische Störung nach ICD-10 (Gesamtprävalenz) (n, %) | 0 (0,0%) | 214 (91,5%) | 113 (89,7%) | 101 (93,5%) | 0,66 (1) | ,417 (0,068)3 |
| Störungskategorien nach ICD-10 | ||||||
| Substanzgebrauchsstörung (n, %) | 0 (0,0%) | 140 (59,8%) | 73 (57,9%) | 67 (62,0%) | 0,25 (1) | ,921 (0,042)3 |
| Schizoforme Störung (n, %) | 0 (0,0%) | 17 (7,3%) | 2 (1,6%) | 15 (13,9%) | – | ,009 (0,236)3 |
| Affektive-, Angst- oder Anpassungsstörung (n, %) | 0 (0,0%) | 26 (11,1%) | 14 (11,1%) | 12 (11,1%) | 0,00 (1) | 1,00 (0,000)3 |
| Persönlichkeitsstörung | 0 (0,0%) | 99 (42,3%) | 56 (44,4%) | 43 (39,8%)
|
0,34 (1) | ,921 (0,047)3 |
| Dissoziale Persönlichkeitsstörung | 0 (0,0%) | 59 (25,2%) | 38 (30,2%) | 21 (19,4%) | 3,00 (1) | ,322 (0,123)3 |
| Intelligenzminderung (ICD-10, F7) | 0 (0,0%) | 5 (2,1%) | 3 (2,4%) | 2 (1,9%) | – | 1,000 (0,018)3 |
| Hyperkinetische Störungen (ICD-10, F90) |
0 (0,0%) | 32 (13,7%) | 17 (13,5%) | 15 (13,9%) | 0,00 (1) | 1,00 (0,006)3 |
| Störung des Sozialverhaltens (ICD-10, F90.1/F91/F92) |
0 (0,0%) | 50 (21,4%) | 32 (25,4%) | 18 (16,7%) | 2,14 (1) | ,322 (0,106)3 |
| Andere psychische Störungen als in den oben genannten Kategorien (n, %) | 0 (0,0%) | 45 (19,2%) | 19 (15,1%) | 26 (24,1%) | 2,48 (1) | ,322 (0,114)3 |
4. Zu den gutachterlichen Eigenschaften/Instrumenten zur Beurteilung der Persönlichkeitsentwicklung
Die forensischen Gutachten wurden überwiegend von Psychiater:innen (76%) oder von Psychiater:innen und Psycholog:innen zusammen (20.1%) verfasst (siehe Tabelle 4).
Der Umfang der gutachterlichen Beurteilung war in den zwei Stichproben vergleichbar, jedoch war die Varianz gross. Lediglich 2% der Sachverständigen setzten für die Beurteilung der Persönlichkeitsentwicklung spezifische, im deutschsprachigen Raum entwickelte Skalen oder Kriterien ein.[44]Bspw.: Marburger-Kriterien/Erweiterung von Villiger von 1955, Kriterien von Esser von 1992, Kriterien der Bonner Delphi Studie von 2003 und 2006, Kriterien von Buch/Köhler von 2019. In 12 Gutachten wurde das Vorliegen einer schweren Persönlichkeitsentwicklungsstörung nicht beurteilt bzw. es wurden keine diesbezüglichen gutachterlichen Fragen gestellt.
Tabelle 4: Angaben zur Begutachtung
| Variablen | Fehlende Werte (%) | Gesamtstichprobe
(n=234) |
Art. 61 StGB (n=126) | Art. 63 StGB (n=108) | Test-Statistik1
(df) |
p-Wert
(Effektstärke) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Profession des/der Referenten (n, %) | 1 (0,4%) | –
|
,363 (0,151)3 | |||
| Psychiater/in | 177 (76,0%) | 96 (76,8%) | 81 (75,0%) | |||
| Psychologe/in | 5 (2,1%) | 2 (0,2%) | 3 (0,3%) | |||
| Psychiater/in und Psychologe/in | 47 (20,1%) | 27 (21,2%) | 20 (18,5%) | |||
| Andere Berufsgruppe | 4 (1,7%) | 0 (0,0%) | 4 (3,7%) | |||
| Umfang Beurteilung (Anzahl Seiten) (M, SD) | 0 (0,0%) | 16,67 (8,73) | 16,05 (8,95) | 15,23 (8,49) | 0,71 (232) | ,477 (0,093)2 |
| Beurteilung der Persönlichkeitsentwicklung | 0 (0,0%) | 135 (57,7%) | 76 (60,3%) | 59 (54,6%) | 0,56 (1) | ,456 (0,057)3 |
| Verwendung Marburger Kriterien (n, %) |
0 (0,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) | – | 1,000 (0,000)3 |
| Verwendung Esser Kriterien (n, %) | 0 (0,0%) | 5 (2,1%) | 3 (2,4%) | 2 (1,9%) | – | 1,000 (0,018)3 |
| Verwendung Bonner Kriterien (n, %) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) | – | 1,000 (0,000)3 |
| Verwendung von Buch/Köhler Kriterien (n, %) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) | – | 1,000 (0,000)3 |
| Beurteilung der Schuldfähigkeit | ||||||
| Einsichtsfähigkeit vermindert (n, %) | 17 (7,3%) | 19 (8,8%) | 3 (2,6%) | 16 (15,8%) | – | ,002 (0,234)3 |
| Steuerungsfähigkeit vermindert (M, SD) |
17 (7,3%) | 135 (61,9%) | 67 (57,3%) | 68 (67,3%) | 1,92 (1) | ,166 (0,103)3 |
| Beurteilung des Rückfallrisikos | ||||||
| Prognose Gewaltdelikt (Skala 1 gering – 3 schwer) (M, SD)4 | 56 (23,9%) | 2.39 (0,61) | 2,41 (0,60) | 2,36 (0,63) | 0,61 (176) | ,816 (0,092)2 |
| Prognose Sexualdelikt (Skala 1 gering – 3 schwer) (M, SD)4 | 202 (86,6%) | 2.00 (0,67) | 2,00(0,47) | 2,00 (0,76) | 0,00 (30) | 1,00 (0,000)2 |
| Prognose Vermögensdelikt (Skala 1 gering – 3 schwer) (M, SD)4 | 81 (34,6%) | 2.48 (0,57) | 2,56 (0,54) | 2,34 (0,60) | 2,39 (151) | ,054 (0,397)2 |
| Massnahmenempfehlung | ||||||
| Massnahme nach Art 61 StGB (n, %) | 0 (0,0%) | 130 (55,6%) | 110 (87,3%) | 20 (18,5%) | 108,66 (1) | ,002 (0,690)3 |
| Massnahme nach Art 63 StGB (n, %) | 0 (0,0%) | 91 (38,9%) | 11 (8,7%) | 80 (74,1%) | 101,75 (1) | ,002 (0,668)3 |
| Massnahme (nach Art 59 StGB/60 StGB) (n, %) | 0 (0,0%) | 18 (7,7%) | 7 (5,6%) | 11 (10,2%) | 1,16 (1) | ,281 (0.087)3 |
IV. Diskussion
Empirische psychologisch-psychiatrische Untersuchungen über die straffällige Population im «Übergangsalter» sind in der Schweiz noch selten und legen den Fokus auf den Verlauf in und nach dem stationären Setting.[45]Endrass et al., 109 ff.; Gerth/Borchard, 116 ff.; Müller/Rossi, 54 ff. Die vorliegende Studie ist die erste systematische Untersuchung von jungen Erwachsenen, bei welchen eine Massnahme nach Art. 61 StGB angeordnet wurde. Nachfolgend sollen die zentralen Ergebnisse kontextualisiert und kritisch gewürdigt werden.
1. Demografie und Delinquenz
Die vorliegenden Auswertungen zeigen, dass Personen mit Massnahmen nach Art. 61 StGB im Rahmen der Altersgruppe der 18–25-jährigen jungen Erwachsenen, welche straffällig geworden sind, etwas jünger waren als die mit einer Massnahme nach Art. 63 StGB und selten eine berufliche Ausbildung abgeschlossen hatten, obwohl sie meistens über einen Schulabschluss verfügten. Fast die Hälfte von ihnen stammte aus Familien mit einem niedrigen sozioökonomischen Status und verfügte nicht über die schweizerische Staatsangehörigkeit. Fast alle wiesen in der Vorgeschichte Verurteilungen auf. Häufig waren sie bereits vorher in einer zivilrechtlichen oder (jugend‑)strafrechtlichen Massnahme. Im Durchschnitt bekamen sie für die aktuelle Anlassdelinquenz (häufig Gewalt- oder Vermögensdelikte) eine mittlere Strafdauer von ca. drei Jahren. Bei fast allen (92,6%) wurde bei der gutachterlichen Beurteilung eine Persönlichkeitsentwicklungsstörung diagnostiziert, bei den meisten (89,7%) wurde aber auch eine psychiatrische Diagnose nach ICD-10 gestellt.
Das Ergebnis, dass Personen mit Massnahmen nach Art. 61 StGB jünger waren als solche mit einer Massnahme nach Art. 63 StGB, kann weitgehend mit dem rechtlichen Rahmen der Massnahme erklärt werden. Bei jüngeren Personen ist das Vorliegen einer Persönlichkeitsentwicklungsstörung und der unzureichenden Bewältigung von altersbedingten Entwicklungsaufgaben wahrscheinlicher.[46]Siehe oben, I. Typischerweise finden sich bei der Stichprobe in der Massnahme nach Art. 61 StGB statistisch signifikant höhere Lehrabbrüche und seltener eine abgeschlossene Ausbildung als bei Probanden mit einer Massnahme nach Art. 63 StGB. Überdies wird mit fortgeschrittenem Alter die Massnahme für junge Erwachsene in der Praxis offensichtlich weniger angeordnet, da sie spätestens mit Vollendung des 30. Altersjahres aufgehoben werden muss.
Massnahmen nach Art. 61 StGB sind in der vorliegenden Stichprobe mehr mit einer ausländischen Nationalität (ca. die Hälfte der Probanden) als Massnahmen nach Art. 63 StGB (ca. ein Drittel der Probanden) assoziiert. Vorgängige Untersuchungen im Kanton Zürich zeigen, dass straffällig gewordene Jugendliche mit Migrationshintergrund v.a. familiär und schulisch stärker belastet sind als Jugendliche ohne Migrationshintergrund.[47]Kilchmann/Bessler/Aebi, 47. Bei ihnen wurden häufiger Gewalt und/oder Kriminalität in der Familie, geistige und/oder körperliche Behinderungen von Familienmitgliedern, ein niedriger sozioökonomischer Status, ein niedriges Schulniveau und häufige Schulabbrüche festgestellt als bei den Jugendlichen ohne Migrationshintergrund. Diese Faktoren können in der Übergangsphase des Erwachsenenwerdens weiterhin eine Rolle spielen und einen Teil der festgestellten Unterschiede zwischen den zwei Stichproben erklären (weniger Ausbildungsabschlüsse, häufigere Lehrabbrüche, niedriger sozioökonomischer Status). Darüber hinaus könnte die sprachliche Barriere den Zugang zu einer ambulanten Massnahme erschweren (z.B. korrekte Erfassung und Diagnose der psychiatrischen Symptomatik und/oder Verfügbarkeit von Personal, das ausländische Personen in deren Muttersprache ambulant therapieren kann).[48]Aebi et al., Massnahmenanordnungen, 38.
Auch wenn junge Erwachsene in einer Massnahme nach Art. 61 StGB die gleichen Häufigkeiten von Schulabschlüssen wie junge Erwachsene mit einer Massnahme nach Art. 63 StGB zeigten, können ein niedriger sozioökonomischer Status sowie eine abweichende Elternsituation sich auf einen erschwerten Zugang zur beruflichen Ausbildung ausgewirkt haben, sodass dann nur knapp 5% von ihnen über eine abgeschlossene Berufsausbildung verfügten. Diese Ergebnisse bestätigen die multiplen Zusammenhänge und weisen auf einen möglichen kumulativen Einfluss von multiplen psychosozialen Belastungen auf die Reifeentwicklung hin.
In Bezug auf die strafrechtliche Vorgeschichte im Jugendalter wies mehr als die Hälfte der gesamten Stichprobe vorgängige jugendstrafrechtliche oder zivilrechtliche Massnahmen auf, was allgemein für eine langanhaltende Vorgeschichte mit Auffälligkeiten spricht. Bei der Analyse der vorgängigen Delinquenz liessen sich keine statistisch relevanten Differenzen feststellen, was die Häufigkeit und Typologie von Delikten und Freiheitsstrafen betrifft. Junge Erwachsene in einer Massnahme nach Art. 61 StGB wiesen lediglich eine höhere Anzahl an früheren Verurteilungen auf. Dies ist mit Blick auf das Verhältnismässigkeitsprinzip kohärent, da bei einer höheren Anzahl Vorstrafen das Rückfallrisiko steigt, was wiederum die höhere Eingriffsintensität mit einer stationären Massnahme rechtfertigen kann.
2. Diagnostische Beurteilung
Die Massnahme nach Art. 61 StGB setzt mit ihrem Eingangskriterium der Störung der Persönlichkeitsentwicklung nicht zwingend eine Diagnose nach anerkannter psychiatrischer Klassifikation wie ICD oder DSM voraus.[49]Urwyler et al., Handbuch, 777. Damit steht sie im Kontrast zu Art. 63 StGB, welcher eine «schwere psychische Störung», eine «Abhängigkeit von Suchtstoffen» oder «andere Abhängigkeit» voraussetzt. Somit wäre die Abbildung von zwei diagnostischen Profilen bei der Analyse der gutachterlichen Beurteilung zu erwarten: ein Profil mit ausgeprägteren Entwicklungsauffälligkeiten, ein anderes mit psychischen Störungen. Bei 92.6% der Probanden mit einer Massnahme nach Art. 61 StGB wurde eine schwere Persönlichkeitsentwicklungsstörung im Gutachten diagnostiziert. Die Diagnose wäre bei allen Probanden mit einer Massnahme nach Art. 61 StGB zu erwarten gewesen. Inwiefern dem Gericht bei der Entscheidungsfindung weitere Elemente für die Anordnung der Massnahme nach Art. 61 StGB vorlagen, ist unklar. Es wäre denkbar, dass weitere (mündliche) gutachterliche Ausführungen und Ergänzungen in die Entscheidung eingeflossen sind, welche in der dieser Studie zugrundeliegenden Dokumentation nicht abgebildet sind und entsprechend nicht berücksichtigt werden konnten. Sollte hingegen tatsächlich ohne entsprechende Störung der Persönlichkeitsentwicklung eine Massnahme angeordnet worden sein, wäre dies mit Art. 5 EMRK sowie Art. 31 BV unvereinbar.
Es wurde jedoch auch bei einer grossen Anzahl von jungen Erwachsenen in einer Massnahme nach Art. 63 StGB (62%) eine schwere Persönlichkeitsentwicklungsstörung identifiziert. Neben der Störung der Persönlichkeitsentwicklung mussten daher weitere Kriterien in Betracht gezogen werden, warum bei einem jungen Erwachsenen keine Massnahme nach Art. 61 StGB angeordnet wurde. Beispielsweise ist denkbar, dass auch die aktuelle Lebenssituation, das Vorhandensein einer beruflichen Ausbildung, oder das Vorhandensein von weiteren komorbiden psychiatrischen Störungen den richterlichen Entscheid mitbeeinflusste.
Die Feststellung, dass die allgemeine Prävalenz von psychischen Störungen bei der gesamten Stichprobe sehr hoch (91.5%) war, deckt sich mit anderen Untersuchungen an forensischen Klienten. Die grosse Überlappung der diagnostizierten psychischen Störungen zwischen den zwei Stichproben, inklusive der Störungsbilder, die sich typischerweise bereits im Kindes- und Jugendalter entwickeln und in das junge Erwachsenenalter hinein persistieren (wie Verhaltens- und Aufmerksamkeitsstörungen oder Intelligenz- und Leistungsstörungen), ist demgegenüber überraschend. Als einzige statistisch relevante Differenz wiesen Probanden in einer Massnahme nach Art. 61 StGB seltener psychotische Störungen (ICD-10: F2) auf, als die in einer Massnahme nach Art. 63 StGB. Dieser Unterschied lässt sich leicht mit den Massnahmenrahmen erklären: Je schwerer eine psychische Störung ausfällt, desto schwieriger wird sich diese im Setting nach Art. 61 StGB adressieren lassen,[50]Urwyler et al., Handbuch, 778. und desto eher wird sich ein Grossteil der deliktpräventiven Behandlungsansätze zur Verbesserung der Legalprognose an der spezifischen (medikamentösen und psychotherapeutischen) Behandlung schwerer psychischer Störung orientieren und somit eher in forensischen Kliniken vollzogen werden. Bei näherer Betrachtung der sonstigen diagnostizierten Störungen liess sich feststellen, dass sich unter den 42% der Probanden mit einer Persönlichkeitsstörung, die in der Massnahme nach Art. 61 StGB befanden, tendenziell mehr dissoziale Persönlichkeitsstörungen zeigten. Die «unreife» (ICD-10: F60.8) oder die «kombinierte und sonstige» Persönlichkeitsstörung (ICD-10: F61) wurden sehr selten diagnostiziert. Vor allem bei den jungen Erwachsenen in einer Massnahme nach Art. 61 StGB wäre aufgrund der Eingangskriterien eine häufigere Diagnosestellung nach ICD-10 F60.8 zu erwarten gewesen. Hier mag es eine Rolle spielen, dass die spezifischen Eingangskriterien für die «unreife» sowie für die «sonstige» Persönlichkeitsstörung in ICD-10 nicht definiert sind.
Persönlichkeitsentwicklungsstörungen und Persönlichkeitsstörungen wurden häufig gleichzeitig diagnostiziert, insbesondere bei Probanden in der Massnahme nach Art. 61 StGB. In der Praxis schliessen sich die zwei Zustandsbilder nicht gegenseitig aus und die Symptome zeigen Überlappungen. Der Krankheitsverlauf sowie die Persönlichkeitsbeeinträchtigungen können bereits in ihrer Art und ihrem Ausprägungsgrad die allgemeinen diagnostischen Kriterien einer Persönlichkeitsstörung erfüllen, auch wenn die betreffenden Personen den Prozess des Erwachsenenwerdens noch nicht abgeschlossen haben. Der bisherige kategoriale Ansatz des ICD-10 konnte bei der Diagnose von Persönlichkeitsstörungen den entwicklungspsychologischen Aspekten nur wenig Rechnung tragen. Mit ICD-11, welches im Jahr 2022 in Kraft trat, wurde im Bereich der Persönlichkeitsstörungen ein Paradigmenwechsel vollzogen. Die Diagnostik verabschiedet sich von einem kategorialen Modell und adaptiert ein dimensionales Modell, in dem die Störungsdiagnose anhand des Schwergrades von Funktionsbeeinträchtigungen (leicht, mittel, schwer) erfolgt.[51]Konrad/Huchzermeier, 85. Zudem wurde das Mindestalter für die Stellung der Diagnose verabschiedet, was die Früherkennung und -behandlung von Persönlichkeitsstörungen begünstigen kann. Perspektivisch könnten somit Persönlichkeitsentwicklungsstörungen eventuell häufiger auch als leicht ausgeprägte Persönlichkeitsstörungen abgebildet werden.
Die hohe Prävalenz bei der vorliegenden Stichprobe von Substanzkonsumstörungen (knapp 60%) legt eine Wechselwirkung von Substanzmissbrauch und Persönlichkeits(entwicklungs)störung nahe. Ein Substanzmissbrauch kann als eine unreife und als inadäquate Copingstrategie betrachtet werden: Junge Menschen erwarten vom Konsum psychotroper Substanzen häufig Hemmungsabbau, Erhöhung des sozialen Status in ihrer Peergroup sowie Entlastung von problematischen Situationen in der Schule oder in der Berufsausbildung oder Symptomreduktion z.B. bei Anspannungen oder umgekehrt Antriebsstörungen. Die neurobiologische Forschung zu Abhängigkeitserkrankungen zeigt, dass der Substanzmissbrauch einerseits Ausdruck der individuellen biologischen Grundlage sein kann,[52]Gardner, 22 ff. andererseits durch fortwährenden Substanzmissbrauch ein ungünstiger Einfluss auf die Gehirnentwicklung entsteht,[53]Albaugh et al., 1031 ff. sodass ein sich gegenseitig negativ beeinflussender Teufelskreis entsteht. Während der Adoleszenz durchläuft das Gehirn signifikante Reifungs- und Umbauprozesse, einschliesslich synaptischem «Pruning» (Abbau von Nervenzellverbindungen, welche funktional nicht benötigt werden) sowie Synaptogenese und Myelinisieren (Neubau und Verstärkung von neuronalen Verbindungen). Diese erhöhte Neuroplastizität und die höhere Empfindlichkeit von jungen Menschen gegenüber Umweltreizen wie Stress und Gruppendruck führen dazu, dass sie ein höheres Risiko haben, mit Substanzen zu experimentieren und Substanzkonsumstörungen zu entwickeln.[54]Martini et al., 258. Weitere Studien belegen den Einfluss von psychopathischen Persönlichkeitsmerkmalen und Substanzmissbrauch insbesondere auf die Entwicklung von antisozialen und Borderline Persönlichkeitsstörungen.[55]Loeber/Burke/Lahey, 24 ff.; Soderstrom et al., 111 ff.; Thatcher/Cornelius/Clark, 1709 ff. Die Ergebnisse weisen auf die Wichtigkeit hin, im Rahmen der Massnahmen den Substanzmissbrauch als Teil der Behandlung zu integrieren.
3. Beurteilung der Persönlichkeitsentwicklungsstörung
Das Konstrukt der Persönlichkeitsentwicklungsstörung wird in der Praxis sehr heterogen hergeleitet.[56]Urwyler/Sidler/Aebi, 14. In der deutschsprachigen Literatur stehen zwar diverse Instrumente zur Verfügung (bspw. Marburger-Kriterien/ Erweiterung von Villiger von 1955[57]Villinger, 1 ff., Kriterien von Esser von 1992[58]Esser/Fritz/Schmidt, 356 ff., Kriterien der Bonner Delphi Studie von 2003[59]Busch/Scholz, 421 ff. und 2006[60]Busch, 52., Kriterien von Buch/Köhler von 2019[61]Von Buch/Köhler, 178 ff.). Solche strukturierten Instrumente fanden in unserer Stichprobe kaum Anwendung (nur in 2,1% der Gutachten). Ein Grund dafür kann sein, dass diese Instrumente in der deutschsprachigen Schweiz wenig bekannt sind. Die fehlende strukturierte Beurteilung ist als problematisch zu beurteilen, weil sie die intersubjektive Reproduzierbarkeit erschwert und anfällig für Verzerrungen ist.[62]Urwylwer/Sidler/Aebi, 36 ff.; Welner et al., 2 ff. Die empirische Evidenz spricht dafür, dass in der Forensik die Anwendung von strukturierten Instrumenten qualitativ bessere Beurteilungen liefert.[63]Gerth/Graf/Weber, 76 f. Das Vorliegen einer schweren Entwicklungsstörung bei jungen Erwachsenen ist für die juristische Entscheidungsfindung wichtig, um Personen zu identifizieren, die spezifische institutionelle Massnahmen benötigen. Wir empfehlen für eine objektivere, transparentere und reproduzierbare Beurteilung die Anwendung von Instrumenten und Checklisten, welche die Einzelfallbeurteilung unterstützen können. Urwyler, Sidler und Aebi haben 2021 einen möglichen Kriterienkatalog vorgelegt, welcher eine strukturierte professionelle Einschätzung des Vorliegens einer Störung der Persönlichkeitsentwicklung nach Art. 61 StGB sowie deren Bezug zum Tatverhalten ermöglichen soll. Das Ziel hierbei ist es, die begutachtende Person, seine entwicklungspsychologischen Aspekte möglichst umfassend darzustellen.
Lediglich ca. 20% der Gutachten wurden von Psychiaterinnen und Psychologen gemeinsam verfasst. Die Interdisziplinarität sollte angesichts der komplexen strafrechtlichen Problemstellung bei einer Begutachtung unterstützt werden, um Aspekte aus dem medizinischen und psychologischen Wissenschaftsbereich zu integrieren.[64]Aebi et al., Gutachten, 1477; Bevilacqua et al., 1 ff. Beide Disziplinen sind je nach gutachterlicher Fragestellung auf die Kompetenz der jeweils anderen Disziplin angewiesen.[65]Urwyler et al., Psycholog:innen als Sachverständige, 20.
4. Stärken und Limitationen
Diese Studie befasst sich mit den Charakteristiken von straffällig gewordenen jungen Erwachsenen, bei welchen eine Massnahme nach Art. 61 StGB, respektive nach Art. 63 StGB angeordnet wurde. Sie basiert auf einer repräsentativen Stichprobe mit aufeinanderfolgenden Fallserien aus den Jahren 2007-2020. Folgende Einschränkungen sind zu erwähnen: 1) Die Studie basiert auf Akten des Kantons Zürich und die Ergebnisse lassen sich nicht unbesehen auf andere Kantone/Länder übertragen. Bisher bestehen keine schweizweiten empirischen Untersuchungen zur Anordnungspraxis von strafrechtlichen Massnahmen nach Art. 61 StGB und keine korrespondierenden Daten des Bundesamtes für Statistik (BFS). 2) Die Stichprobe ist in ihrer Grösse limitiert. Eine umfassendere Stichprobe könnte die Tendenzen, welche zu beobachten waren, aber sich als nicht statistisch signifikant erwiesen, bestätigen oder widerlegen. 3) Es können keine Aussagen zu weiblichen Probanden gemacht werden, da bei der untersuchten Stichprobe bei keiner weiblichen Person eine Massnahme nach Art. 61 StGB angeordnet wurde. Dies ist möglicherweise vor dem Hintergrund zu beurteilen, dass es schweizweit keine spezialisierten Institutionen gibt, die sich spezifisch auf Massnahmen nach Art. 61 StGB für Frauen konzentriert haben. Entsprechend ist es plausibel, dass Sachverständige bei weiblichen beschuldigten Personen teilweise keine Massnahme nach Art. 61 StGB empfehlen. Hier dürfte Entwicklungsbedarf vorliegen, um auch jungen erwachsenen weiblichen Personen adäquate sozialpädagogische Strukturen zu ermöglichen. 4) Es wurden nur sehr wenige jugendstrafrechtliche Vor-Gutachten erfasst, welche aufgrund der geringen Anzahl nicht statistisch ausgewertet werden konnten. Mögliche Vordiagnosen von psychischen Störungen, welche typischerweise ihre ersten Manifestationen in der Kindheit zeigen (wie ADHS, Verhaltensstörungen, Intelligenz-/Leistungsstörungen sowie Störungen der Persönlichkeitsentwicklung) konnten daher nicht untersucht werden.
V. Schlussfolgerungen
Die Diagnose einer schweren Störung der Persönlichkeitsentwicklung ist juristisch ausschlaggebend, um eine Massnahme für junge Erwachsene nach Art. 61 StGB anzuordnen. Dennoch zeigt sie sich nicht als spezifische Indikations-Diagnose, da sie auch bei einem relevanten Anteil der Probanden mit einer Massnahme nach Art. 63 StGB diagnostiziert wurde. In Bezug auf die anderen analysierten Parameter konnten bei den jungen Erwachsenen, die nach Art. 61 StGB behandelt wurden, nur wenige statistisch relevante Unterschiede hinsichtlich Demographie, psychischer Störungen und Delinquenz im Vergleich zu den jungen Erwachsenen festgestellt werden, die nach Art. 63 StGB behandelt wurden. Die Einflussfaktoren, welchen die behördliche Entscheidung für eine oder für die andere Massnahme unterliegt, bleiben partiell ungeklärt und müssen weiter untersucht werden.
Mit Blick auf die Eingangskriterien für den Art. 61 StGB und die gutachterliche Beurteilung der Persönlichkeitsentwicklung gibt es Grund zur Annahme, dass die Beurteilung anhand von klinischen Gesichtspunkten erfolgt und evidenzbasierte strukturierte Verfahren zur Einschätzung der Reife nur selten angewendet werden. Die Befunde dieser Untersuchung weisen darauf hin, dass klarere Kriterien für Sachverständige und Gerichte für die Empfehlung und Einweisung in die Massnahme nach Art. 61 StGB notwendig sind. Das Konzept der Persönlichkeitsentwicklungsstörung und dessen Diagnostik sollten genauer operationalisiert werden, um forensische Sachverständige bei der Beurteilung der Persönlichkeitsentwicklung entscheidend zu unterstützen und somit Verzerrungen bei der Entscheidungsfindung zu vermeiden. Im Artikel von Urwyler, Sidler und Aebi[66]Urwyler/Sidler/Aebi, 75 ff. wird ein solches strukturiert-professionelles Instrument für eine professionelle Einschätzung des Vorliegens einer erheblichen Störung der Persönlichkeitsentwicklung sowie deren Bezug zum Tatverhalten empfohlen.
Die Probanden, die sich in einer Massnahme nach Art. 63 StGB befanden, weisen zahlreiche Ähnlichkeiten mit den Probanden in einer Massnahme nach Art. 61 StGB auf (z.B. bezüglich Persönlichkeitsentwicklungsstörung, Ausbildung angeordneter Freiheitstrafen). Es braucht klarere Kriterien, um die jungen Erwachsenen zu identifizieren, die bspw. altersbedingt oder aufgrund der psychiatrischen Diagnose oder bereits erfolgter beruflicher Ausbildung besser für die Massnahme nach Art. 63 StGB – oder die aufgrund ihres noch rückständigen Ausbildungs- und Entwicklungsstandes besser für eine Massnahme nach Art. 61 StGB geeignet wären. Das genauere Identifizieren des Massnahmenbedarfs könnte langfristig eine erfolgreiche, straffreie Wiedereingliederung in die Gesellschaft fördern und somit zum Erfolg von strafrechtlichen Massnahmen allgemein beitragen.
Literaturverzeichnis
Adam Albert/Breithaupt-Peters Monique, Persönlichkeitsentwicklungsstörungen bei Kindern und Jugendlichen: Ein integrativer Ansatz für die psychotherapeutische und sozialpädagogische Praxis, 2. A., Stuttgart 2010.
Aebi Marcel et al., Assessing psychosocial maturity to diagnose severe personality development disorders in young adult males adjudicated of serious criminal offenses, 2024, in review (zit. Aebi et al., Psychosocial maturity).
Aebi Marcel et al., Jugendstrafrechtliche Gutachten in der Schweiz, Anforderungen aus juristischer, psychologischer und psychiatrischer Sicht, AJP/PJA 2018, 1477 ff. (zit. Aebi et al., Gutachten).
Aebi Marcel et al., Massnahmenanordnungen bei jungen Erwachsenen: Ergebnisse einer empirischen Untersuchung im Kanton Zürich, NKrim 2023, 38 ff. (zit. Aebi et al., Massnahmenanordnungen).
Albaugh Matthew D. et al., Association of Cannabis Use During Adolescence with Neurodevelopment, JAMA Psychiatry 2021, 1031 ff.
Benjamini Yoav/Hochberg Yosef, Controlling the false discovery rate: a practical and powerful approach to multiple testing. Journal of the Royal statistical society: series B (Statistical Methodology) 1995, 289 ff.
Bevilacqua Leonie et al., Expert opinions on criminal law cases in Switzerland – an empirical pilot study, Swiss medical weekly 2023, 1 ff.
Blonigen Daniel M., Explaining the relationship between age and crime: Contributions from the developmental literature on personality, Clinical Psychology Review 2010, 89 ff.
Bryan-Hancock Claire/Casey Sharon, Psychological maturity of at-risk juveniles, young adults and adults: Implications for the justice system, Psychiatry, Psychology and Law 2010, 57 ff.
Busch Thomas P., Rechtspsychologische Begutachtung delinquenter Heranwachsender: Evidenzbasierte Entscheidungsalgorithmen zur strafrechtlichen Zuweisung gemäss § 105 JGG, Diss., Berlin 2006, 52 f.
Busch Thomas P./Scholz Berndt, Neuere Forschung zum § 105 JGG – Die Bonner Delphi-Studie: Ein Zwischenbericht, MschrKrim 2003, 421 ff.
Cohen Jacob, Statistical power analysis for the behavioral sciences, 2. A., New Jersey 1988.
De Tribolet-Hardy Fanny/Lehner Chris/Habermeyer Elmar, Forensische Psychiatrie ohne Diagnosen, FPPK 2015, 168 ff.
Dünkel Friederich/Geng Bernd/Passow Daniel, Neuere Erkenntnisse der Neurowissenschaften zur Gehirnentwicklung («brain maturation») und Implikationen für ein Jungtäterstrafrecht. Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform, 20 ZJJ 2/2017, 115 ff.
Endrass Jérôme et al., Legalbewährung junger Straftäter nach Entlassung aus Arbeitserziehungsmassnahmen, Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie 2007, 109 ff.
Endrass Jérôme/Rossegger Astrid/Kuhn Bettina, Kosten-Nutzen-Effizienz von Therapien, in: Endrass Jérôme et al. (Hrsg.), Interventionen bei Gewalt- und Sexualstraftätern: Riskmanagement, Methoden und Konzepte der forensischen Therapie, Berlin 2013, 77 ff.
Esser Günter/Fritz Annemarie/Schmidt Martin, Die Beurteilung der sittlichen Reife Heranwachsender im Sinne des § 105 JGG – Versuch einer Operationalisierung 1992, 356 ff.
Galambos Nancy et al., Cognitive performance differentiates selected aspects of psychosocial maturity in adolescence, Developmental neuropsychology 2005, 473 ff.
Gardner Eliot L., Introduction: Addiction and Brain Reward and Anti-Reward Pathways, Adv Psychosom Med. 2011, 22 ff.
Gerth Juliane/Borchard Bernd, Aspekte des modernen Straf- und Massnahmenvollzugs: Die Wirksamkeit resozialisierender Interventionen bei Gewalt und Sexualstraftätern im Amt für Justizvollzug des Kantons Zürich, SZK 2009, 112 ff.
Gerth Juliane/Graf Marc/Weber Michael, Kognitive Verzerrungen im forensischen Kontext: Zuverlässigere Risikobeurteilungen durch Debiasing?, Praxis der Rechtspsychologie 2022, 69 ff.
Habermeyer et al., Psychologen im Strafverfahren. Wie weiter nach dem Bundesgerichtsurteil BGer 6B_884/2014 vom 8. April 2015?, AJP/PJA 2016, 127 ff.
Harris Paul A. et al., The REDCap consortium: Building an international community of software platform partners. Journal of biomedical informatics 2019, 95 ff.
Havighurst Robert J., Research on the developmental-task concept, The School Review 1956, 215 ff.
International Labour Organisation. International Standard Classification of Occupations (ISCO), abrufbar unter: <http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/isco08/>, 2008.
Kilchmann Lara/Bessler Cornelia/Aebi Marcel, Psychosoziale Belastungen und psychische Auffälligkeiten von jugendlichen Straftätern mit und ohne Migrationshintergrund, FPPK 2015, 47.
Konrad Norbert/Huchzermeier Christian, ICD-11: Ändert sich die forensisch-psychiatrische Begutachtung im Strafrecht?, R & P 2019, 85.
Konrad Kerstin/Klinger-König Johanna, Biopsychologische Veränderungen, in: Arnold Lohaus (Hrsg.), Entwicklungspsychologie des Jugendalters, 4. A., Berlin 2019, 1 ff.
Laub John H./Sampson Robert J., Shared Beginnings, Divergent Lives: Delinquent Boys to Age 70, Harvard University Press 2003, 150 ff.
Lipsey Mark W./Cullen Francis T., The effectiveness of correctional rehabilitation: A review of systematic reviews. Annu. Rev. Law Soc. Sci. 2007, 297 ff.
Loeber Rolf/Burke Jeffrey D./Lahey Benjamin B., What are adolescent antecedents to antisocial personality disorder?, Criminal Behaviour and Mental Health 2002, 24 ff.
Manning Lee M., Havighurst’s developmental tasks, young adolescents, and diversity, The Clearing House 2002, 75 ff.
Martini Francesca et al., Substance-Related Disorders, in: Cavallaro Roberto/Colombo Cristina (Hrsg.), Fundamentals of Psychiatry for Health Care Professionals, 1. A., Milano 2022, 268.
Moffitt Terrie Edith, Adolescence-limited and life-course-persistent antisocial behavior: A developmental taxonomy, Psychological review 1993, 674 ff.
Monahan Kathryn C. et al., Trajectories of antisocial behavior and psychosocial maturity from adolescence to young adulthood, Developmental psychology 2009, 1654 ff (zit. Monahan et al., Antisocial behavior).
Monahan Kathryn C. et al., Psychosocial (im)maturity from adolescence to early adulthood: Distinguishing between adolescence-limited and persisting antisocial behavior, Development and Psychopathology 2013, 1093 ff (zit. Monahan et al., Psychosocial (im)maturity).
Remschmidt Helmut/Schmidt Martin/Poustka Fritz (Hrsg.), Multiaxiales Klassifikationsschema für psychische Störungen des Kindes- und Jugendalters nach ICD-10 der WHO, 7. A. 2017, 1 ff.
Müller Daniel/Rossi David, Rückfall nach Massnahmenvollzug. Eine Studie zur Rückfälligkeit von jungen Erwachsenen aus den Massnahmenzentren Arxhof und Uitikon, Niederdorf 2009, 1 ff.
Nixon Timothy, The Relationships between Age, Psychosocial Maturity, and Criminal Behavior, Diss., Cincinnati 2020, 1 ff.
Odgers Candice L. et al., Female and male antisocial trajectories: From childhood origins to adult outcomes, Development and Psychopathology 2008, 673 ff.
Pruin Ineke, Die Heranwachsendenregelung im deutschen Jugendstrafrecht, Jugendkriminologische, entwicklungspsychologische, jugendsoziologische und rechtsvergleichende Aspekte, Diss., Mönchengladbach 2007, 19.
Rocque Michael/Posick Chad/Hoyle Justin, Age and crime, in: Jennings Wesley G. (Hrsg.), The encyclopedia of crime and punishment, 1. A., 2016, 1 ff.
Soderstrom Henrik et al., The childhood-onset neuropsychiatric background to adulthood psychopathic traits and personality disorders, Comprehensive Psychiatry 2005, 111 ff.
Steinberg Laurence, Risk taking in adolescence: New perspectives from brain and behavioral science, Current Directions in Psychological Science 2007, 55 f.
Steinberg Laurence/Cauffman Elisabeth, Maturity of judgment in adolescence: Psychosocial factors in adolescent decision making. Law and Human Behavior 1996, 249 ff.
Steinberg Laurence/Cauffman Elisabeth/Monahan Kathryn C., Psychosocial maturity and desistance from crime in a sample of serious juvenile offenders: US Department of Justice, Office of Justice Programs, Juvenile justice Bulletin 2015, 1 ff.
Stelly Wolfang/Thomas Jürgen, Kriminalität im Lebenslauf, Tübingen 2005, 117 ff.
Thatcher Dawn L./Cornelius Jack R/Clark Duncan B., Adolescent alcohol use disorders predict adult borderline personality, Addictive Behaviors 2005 1709 ff.
Urwyler Thierry et al., Handbuch Strafrecht – Psychiatrie – Psychologie, Basel 2022, 1 ff. (zit. Urwyler et al., Handbuch).
Urwyler Thierry et al., Psycholog:innen als Sachverständige für Gutachten zur Schuldfähigkeit und Massnahmenindikation im Erwachsenenstrafrecht, Falsifikation der bundesgerichtlichen Thesen in BGE 140 IV 49, sui generis 2024, 1 ff. (zit. Urwyler et al., Psycholog:innen als Sachverständige).
Urwyler Thierry/Sidler Christoph/Aebi Marcel, Massnahmen für junge Erwachsene nach Art. 61 StGB: Beurteilung der erheblich gestörten Persönlichkeitsentwicklung, Basel 2021, 17 ff.
Villinger Werner, Das neue Jugendgerichtsgesetz aus jugendpsychiatrischer Sicht, Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie 1955, 1 ff.
Von Buch Jennifer/Köhler Denis, Jugendlich oder erwachsen? Standards in der Beurteilung der strafrechtlichen Verantwortungsreife, RPsych 2019, 178 ff.
Welner Michael et al., Forensic assessment of criminal maturity in juvenile homicide offenders in the United States. Forensic Science International: Mind and Law 2023, 2 ff.
Fussnoten[+]
| ↑1 | Odgers et al., 673 ff.; Rocque/Posick/Hoyle, 1 ff. |
|---|---|
| ↑2 | Endrass/Rossegger/Kuhn, 77 ff.; Lipsey/Cullen, 314. |
| ↑3 | De Tribolet-Hardy/Lehner/Habermeyer, 169. |
| ↑4 | Seit der letzten umfassenden Revision des schweizerischen Massnahmenrechts im Jahr 2007 ist die Massnahme für junge Erwachsene nach Art. 61 StGB in der aktuellen Form ein fester Bestandteil des schweizerischen Strafrechts. Der Vorläufer dieser Massnahme war der Art. 100bis aStGB (Einweisung in eine Arbeitserziehungsanstalt). |
| ↑5 | Havighurst, 215. |
| ↑6 | Manning, 75. |
| ↑7 | Konrad/Klinger-König, 1 ff. |
| ↑8 | Dünkel/Geng/Passow, 115 f. |
| ↑9 | Dünkel/Geng/Passow, 116 ff. |
| ↑10 | Siehe z.B. Blonigen, 89 ff. und Moffitt, 674 ff. |
| ↑11 | Laub/Sampson, 150 ff. |
| ↑12 | Stelly/Thomas, 117 ff. |
| ↑13 | Bryan-Hancock/Casey, 57; Nixon, 8. |
| ↑14 | Bryan-Hancock/Casey, 58. |
| ↑15 | Steinberg, 55. |
| ↑16 | Galambos et al., 487. |
| ↑17 | Steinberg/Cauffman, 249 ff. |
| ↑18 | Monahan et al., Antisocial Behavior, 1654 ff.; Monahan et al., Psychosocial (im)maturity, 1093 ff.; Steinberg/Cauffman/Monahan, 1 ff. |
| ↑19 | Monahan et al., Psychosocial (im)maturity, 1093 ff. |
| ↑20 | Massnahmenzentrum (MZ) Arxhof (Basel-Land), MZ Kalchrain (Kanton Thurgau), Centre éducatif de Pramont (Kanton Wallis) und MZ Uitikon (Kanton Zürich). |
| ↑21 | Aebi et al., Massnahmenanordnungen, 37 f. |
| ↑22 | Aebi et al., Psychosocial maturity, 4; Habermeyer et al., 127 ff. |
| ↑23 | Urwyler/Sidler/Aebi, 14. |
| ↑24 | International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems. |
| ↑25 | Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. |
| ↑26 | Adam/Breithaupt-Peters, 47 ff.; Urwyler/Sidler/Aebi, 14. |
| ↑27 | Urwyler/Sidler/Aebi, 29. |
| ↑28 | Pruin, 19. |
| ↑29 | Villinger, 1 ff. |
| ↑30 | Esser/Fritz/Schmidt, 356 ff. |
| ↑31 | Busch/Scholz, 421 ff. |
| ↑32 | Busch, 52. |
| ↑33 | Von Buch/Köhler, 178 ff. |
| ↑34 | Urwyler/Sidler/Aebi, 75 ff. |
| ↑35 | Urwyler et al., Handbuch, 785. |
| ↑36 | Die ICD-10 stellt die zehnte Version der ICD dar. Die ICD-11 trat erst im Jahr 2022 in Kraft. |
| ↑37 | Das sogenannte «broken home»: unvollständige Familie, Abwesenheit eines Elternteils als Folge von Ehescheidung, Tod, Getrenntleben oder sonstigen Umständen. |
| ↑38 | Antrag 2023-00548 von 03. Mai 2023. |
| ↑39 | Harris et al., 95 ff. |
| ↑40 | International Labour Organisation. International Standard Classification of Occupations (ISCO). |
| ↑41 | Cohen, 1988. |
| ↑42 | Benjamini/Hochberg, 289 ff. |
| ↑43 | Multiaxiales Klassifikationsschema nach ICD-10, Z60.1: Heterogene Spannbreite von Situationen, die sich von der traditionellen Norm der Erziehung durch zwei biologische Eltern unterscheidet und bei denen sich empirische Hinweise einer statistischen Beziehung zu einer erhöhten psychiatrischen Gefährdung findet, 429. |
| ↑44 | Bspw.: Marburger-Kriterien/Erweiterung von Villiger von 1955, Kriterien von Esser von 1992, Kriterien der Bonner Delphi Studie von 2003 und 2006, Kriterien von Buch/Köhler von 2019. |
| ↑45 | Endrass et al., 109 ff.; Gerth/Borchard, 116 ff.; Müller/Rossi, 54 ff. |
| ↑46 | Siehe oben, I. |
| ↑47 | Kilchmann/Bessler/Aebi, 47. |
| ↑48 | Aebi et al., Massnahmenanordnungen, 38. |
| ↑49 | Urwyler et al., Handbuch, 777. |
| ↑50 | Urwyler et al., Handbuch, 778. |
| ↑51 | Konrad/Huchzermeier, 85. |
| ↑52 | Gardner, 22 ff. |
| ↑53 | Albaugh et al., 1031 ff. |
| ↑54 | Martini et al., 258. |
| ↑55 | Loeber/Burke/Lahey, 24 ff.; Soderstrom et al., 111 ff.; Thatcher/Cornelius/Clark, 1709 ff. |
| ↑56 | Urwyler/Sidler/Aebi, 14. |
| ↑57 | Villinger, 1 ff. |
| ↑58 | Esser/Fritz/Schmidt, 356 ff. |
| ↑59 | Busch/Scholz, 421 ff. |
| ↑60 | Busch, 52. |
| ↑61 | Von Buch/Köhler, 178 ff. |
| ↑62 | Urwylwer/Sidler/Aebi, 36 ff.; Welner et al., 2 ff. |
| ↑63 | Gerth/Graf/Weber, 76 f. |
| ↑64 | Aebi et al., Gutachten, 1477; Bevilacqua et al., 1 ff. |
| ↑65 | Urwyler et al., Psycholog:innen als Sachverständige, 20. |
| ↑66 | Urwyler/Sidler/Aebi, 75 ff. |