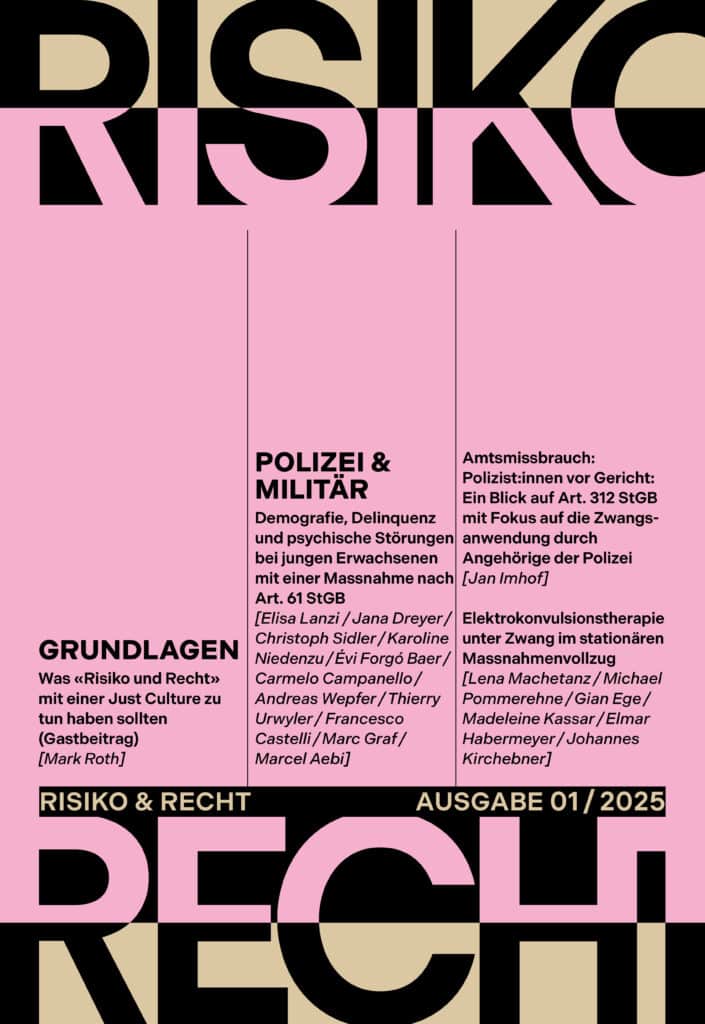Inhalt
- Einleitung
- Vorbemerkung zum Gewaltmonopol
- Geschütztes Rechtsgut
- Kognition der Strafbehörden
- Objektiver Tatbestand
- Subjektiver Tatbestand
- Rechtfertigungsgründe
- Konkurrenz und Abgrenzung
- Auswirkung von Art. 312 StGB
- Schlussbemerkung
- Literaturverzeichnis
I. Einleitung
Angehörige der Polizei sehen sich aufgrund ihres Auftrags und ihrer Kompetenzen einem erhöhten Risiko ausgesetzt, sich für ihr Handeln vor den Strafbehörden erklären zu müssen. Die Strafuntersuchung wegen Amtsmissbrauchs ist oftmals die einzige faktische Möglichkeit, einen Polizeieinsatz unabhängig überprüfen zu lassen. Verwaltungsverfahren auf Feststellung der Widerrechtlichkeit eines Polizeieinsatzes und/oder Staatshaftung sind äusserst selten. Zudem werden sie erstinstanzlich meist von einer Verwaltungsjustizbehörde und erst zweitinstanzlich von einem verwaltungsunabhängigen Gericht (zumeist Verwaltungsgericht) behandelt. Dieser Rechtsweg setzt einiges an finanziellen und zeitlichen Ressourcen voraus. Ebenso selten sind Administrativuntersuchungen[1]Beispiel: Oberholzer Niklaus, Bericht über die Abklärungen von Vorwürfen im Bereich der Sicherheit in den Bundesasylzentren, erstattet im Auftrag des Staatsekretariats für Migration (SEM) vom … Continue reading oder formlose Untersuchungen.[2]Vgl. auch Sturm Evelyne/Locher Reto/Künzli Jörg/Wyttenbach Judith, Umgang mit Beschwerden gegen die Stadtpolizei Zürich, Schweizerisches Kompetenzzentrum für Menschenrecht (SKMR), 28. Februar … Continue reading Somit bleibt in aller Regel nur das Strafverfahren, in welchem nicht nur ein mögliches individuelles Fehlverhalten, sondern – jedenfalls bruchstückhaft – ein Polizeieinsatz beurteilt werden kann. Die Polizeikommandos leiten aus diesen strafrechtlichen Urteilen allgemeine Konsequenzen für die Ausbildung, Einsatzdoktrin und Dienstbefehle ab. Im medialen Mittelpunkt bleibt aber häufig die beschuldigte Person hängen, welche die Amtshandlung vorgenommen hat.[3]Illustrativ die Richtlinienmotion 224-2023 im Grossen Rat des Kantons Bern mit dem Titel «Missbrauch durch Medien-Konzern: Kantonsangestellte schützen». Umso wichtiger erscheint es, den Straftatbestand des Amtsmissbrauchs (Art. 312 StGB)[4]Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 (StGB, SR 311.0). im Hinblick auf polizeiliches Handeln genauer zu beleuchten. Er lautet:
«Mitglieder einer Behörde oder Beamte, die ihre Amtsgewalt missbrauchen, um sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen oder einem andern einen Nachteil zuzufügen, werden mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.»
II. Vorbemerkung zum Gewaltmonopol
Das Gewaltmonopol gehört zur DNA des Rechtsstaates. Die Durchsetzung der demokratisch legitimierten Regeln einer Gesellschaft soll nicht nach jedermanns Gutdünken (Faust- und Fehderecht), sondern durch ein Organ, den Staat, erfolgen. Damit werden Rechtssicherheit und -gleichheit gestärkt und Willkür eingedämmt. Ideengeschichtlich ist das Gewaltmonopol mannigfach verwurzelt[5]Für eine Übersicht vgl. Kley, passim, sowie Mohler, Gewaltmonopol, passim. und wurde in der neuzeitlichen Rechtsphilosophie namentlich vom französischen Staatstheoretiker Jean Bodin sowie den Philosophen des britischen Rationalismus Thomas Hobbes und John Locke geprägt. Für Bodin bedeutete Souveränität, die höchste Befehlsgewalt innezuhaben (Majestas est summa in cives ac subditos legibusque soluta potestas), welche es zum Zweck eines wohlgeordneten Staatswesens einzusetzen galt.[6]Bodin, Buch I, 8. Kapitel, Rz. 122. Vgl. auch 10. Kapitel, Rz. 216; Buch III, 4. Kapitel, Rz. 409, und 5. Kapitel passim; Buch IV, 1. Kapitel, Rz. 503. Der Vertragstheoretiker Hobbes geht seinerseits von einem grundsätzlich schlechten Menschenbild aus. Das Leben sei solitary, poor, nasty, brutish and short und ohne mächtigen Herrscher drohe ein Krieg aller gegen alle (bellum omnium contra omnes), denn der Mensch ist des Menschen Wolf (homo homini lupus). Zur Bekämpfung dieses negativen Naturzustands plädiert er für den Rechtsverzicht der Einzelnen zu Gunsten eines Dritten, des Staates.[7]Hobbes, 17. Kapitel, S. 155: «[Der] Staat ist eine Person, deren Handlung eine grosse Menge Menschenkraft der gegenseitigen Verträge eines jeden mit einem jeden als ihre eigenen ansehen, auf dass … Continue reading Locke, ebenfalls Vertragstheoretiker, geht im Unterschied zu Hobbes von einem positiven Naturzustand mit live, liberty und estate aus. Eine Selbstsicherung dieser Rechte erachtet auch Locke als unbefriedigend und schwierig, weshalb sie von einer hoheitlichen Sicherung abgelöst werden sollte.[8]Locke, 2. Buch, 9. Kapitel, §130, S. 280: «Die zweite Gewalt, nämlich die Gewalt, gibt er [Anm.: der Bürger], vollständig auf und verpflichtet seine natürliche Kraft […], um die exekutive … Continue reading Ihnen allen ist damit gemein, dass sie in der Monopolisierung der Macht den zentralen Weg für eine friedliche Koexistenz erblicken.
In der modernen Schweiz liegt das Gewaltmonopol beim Staat.[9]BGE 148 II 218 E. 4.4 S. 225 m.w.H. Obschon es zum materiellen Verfassungsrecht[10]Moeckli, 2273. gehört, wird es von der Bundesverfassung und den meisten Kantonsverfassungen[11]Ausnahmen bilden namentlich Art. 44 Abs. 1 Constitution du Canton de Vaud vom 14. April 2003 (KV/VD, BLV 101.01): «Dans les limites de ses compétences, l’État détient le monopole de la force … Continue reading nicht ausdrücklich genannt und erst auf Gesetzesstufe vereinzelt erwähnt.[12]Beispiel: Art. 12 Abs. 1 Polizeigesetz des Kantons Bern vom 10. Februar 2019 (PolG/BE, BSG 551.1) mit dem Sachtitel «Gewaltmonopol der Kantonspolizei» erklärt für die Anordnung und den Einsatz … Continue reading Viel häufiger ergibt sich das Gewaltmonopol aus a) der demokratischen Ermächtigung einer Behörde bzw. deren Amtspersonen, zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben Zwang anzuwenden,[13]Exemplarisch: § 20 Abs. 1 des Gesetzes über die Luzerner Polizei vom 27. Januar 1998 (PolG/LU, SRL Nr. 350): «Die Luzerner Polizei kann zur Erfüllung ihrer Aufgaben unmittelbaren Zwang gegen … Continue reading bei b) gleichzeitigem Gewaltverbot[14]Vorbehalten bleiben die Jedermannsrechte wie die Notwehr(hilfe), Notstands(hilfe), das allgemeine Festhalterecht oder der zivilrechtliche Besitzesschutz. der Bevölkerung,[15]Tschannen, §5 Rz 13: «Dem Gewaltmonopol zugunsten des Staats entspricht als Kehrseite das Gewaltverbot und die Friedenspflicht zulasten der Bürger». welches durch das Strafrecht bestimmt ist.
III. Geschütztes Rechtsgut
Gemäss herrschender Lehre schützt Art. 312 StGB einerseits das Interesse des Staates, dass seine Amtspersonen die hoheitlichen Befugnisse rechtmässig ausüben (Kontrollfunktion).[16]BSK StGB-Heimgartner, Art. 312 Rz. 4; PK StGB-Trechsel/Vest, Art. 312 Rz. 1; AK StGB-Wyler/Michlig, Art. 312 Rz. 1; CR CP-Postizzi, Art. 312 Rz. 5; Frey/Omlin, 83 f. Das Strafrecht ergänzt damit personalrechtliche Massnahmen. Andererseits bezweckt Art. 312 StGB die Bevölkerung vor missbräuchlichem Zwang zu schützen und das Vertrauen in die Integrität der Amtspersonen zu stärken[17]CR CP-Postizzi, Art. 312 Rz. 4: «Si le citoyen peut être l’objet de mesures de contrainte de la part de l’Etat, dans le même temps il doit avoir la possibilité d’exiger que les principes … Continue reading (Schutzfunktion und vertrauensbildende Massnahme)[18]Vgl. dazu die vorerwähnten Kommentatoren zu Art. 312 a.a.O. sowie explizit die Botschaft des Bundesrates vom 23. Juli 1918 an die Bundesversammlung zu einem Gesetzesentwurf enthaltend das … Continue reading. Art. 312 StGB schützt so sowohl individuelle als auch kollektive Interessen.[19]Urteil des Bundesgerichts 6B_837/2018 vom 9. November 2018 E. 4.2. Die genannten Stossrichtungen lassen sich unter das staatliche Gewaltmonopol subsumieren. Der Straftatbestand ist mithin als ein Kontrollinstrument zu verstehen, wie der Staat und die Bevölkerung das den Amtspersonen zugestandene und von diesen gelebte Gewaltmonopol einer gerichtlichen Kontrolle unterziehen können.
IV. Kognition der Strafbehörden
Die Strafbehörden haben die gegenständliche Amtshandlung auf ihre Recht- und Verhältnismässigkeit zu untersuchen (vgl. nachfolgend Ziff. V.3.). Hinsichtlich des Ermessens beschränkt sich die Kognition auf den Ermessensmissbrauch, d.h. die Rechtsverletzung bei der Ermessensausübung.[20]BSK StGB-Heimgartner, Art. 312 Rz. 8. Ob die Amtshandlung angemessen war, wird von der Strafbehörde nicht geprüft und bildet u.U. Gegenstand des personalrechtlichen Verfahrens oder des Verfahrens um Ansprüche aus Staatshaftung (vgl. nachfolgend Ziff. IX.). Die Kognition beim Amtsmissbrauch deckt sich so mit jener beim Ungehorsam gegen amtliche Verfügungen (Art. 292 StGB). Diesbezüglich können die Strafbehörden die zugrundeliegende Verfügung (bspw. Wegweisung) auch nicht auf ihre Angemessenheit überprüfen.[21]BGE 129 IV 246 E. 2.3 S. 250.
V. Objektiver Tatbestand
1. Täterkreis «Beamte»
Art. 312 StGB ist als Sonderdelikt ausgestaltet und kann nur durch Beamte gemäss der Legaldefinition in Art. 110 Abs. 3 StGB begangen werden. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist für die Beamtenstellung entscheidend, ob die übertragene Funktion amtlicher Natur ist. Der strafrechtliche Beamtenbegriff erfasst demnach sowohl institutionelle als auch funktionelle Beamte.[22]BGE 141 IV 329 E. 1.3 S. 331. Richtigerweise fallen so auch Mitarbeitende der nach dem BGST[23]Bundesgesetz über die Sicherheitsorgane der Transportunternehmen im öffentlichen Verkehr vom 18. Juni 2010 (BGST, SR 745.2). bewilligten Sicherheitsdienstleister in den persönlichen Geltungsbereich.[24]Beschluss der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts BB.2022.83 vom 12. April 2023 E. 2.4. Nach hier vertretener Auffassung ist für den persönlichen Geltungsbereich unbeachtlich, ob die Amtsperson in ihrer Funktion Zwang anwenden durfte oder nicht.[25]A.M. BSK StGB-Heimgartner, Art. 312 Rz. 5, sowie AK StGB-Wyler/Michling, Art. 312 Rz. 3; ebenso Frey/Omlin, 84, und wohl auch CR CP-Postizzi, Art. 312 Rz. 20; vgl. aber auch PK … Continue reading Entscheidend ist, ob die Täterschaft den institutionellen oder funktionellen Beamtenbegriff erfüllt. Eine fehlende Befugnis, Zwang anzuwenden, ist beim Tatobjekt («ihre Amtsgewalt») zu beurteilen und nicht bei der Täterqualifikation.
2. Tatobjekt «ihre Amtsgewalt»
Der Sachtitel «Amtsmissbrauch» lässt vermuten, dass jeglicher Missbrauch eines Amtes unter Strafe gestellt wird. Dies trifft jedoch gerade nicht zu. Nicht jede unrechtmässige Amtshandlung (Verfügung/Realakt) fällt unter den strafrechtlichen Schutz von Art. 312 StGB, selbst wenn sie in einem späteren verwaltungsrechtlichen Verfahren reformiert oder kassiert wird. Geschützt ist nur die Amtsgewalt, also jene Amtshandlung, die Zwang mit sich bringt[26]Etwa verneint bei der Genehmigung einer Verteilungsliste und Schlussrechnung nach einem Bankenkonkurs; Urteil des Bundesstrafgerichts SK.2015.35 vom 10. November 2015 E. 2.3.2. (als Ausfluss des Gewaltmonopols, Recht vollstrecken zu können). Der Sachtitel ist daher ungenau und der Tatbestand restriktiv anzuwenden.[27]BSK StGB-Heimgartner, Art. 312 Rz. 4 mit Verweis auf BGE 88 IV 66 S. 69.
Der Amtsmissbrauch unterscheidet sich so von anderen verwandten Strafnormen wie dem Missbrauch der Befehlsgewalt (Art. 66 MStG)[28]Militärstrafgesetz vom 13. Juni 1927 (MStG, SR 321.0). oder der im deutschen Recht bekannten Rechtsbeugung (§339 StGB/DE)[29]Das deutsche Recht kennt selbstredend auch in §302 StGB/DE, Missbrauch der Amtsgewalt, ein Pendant zu Art. 312 StGB.. So ist der Missbrauch der Befehlsgewalt bereits mit der Erteilung des Befehls erfüllt.[30]Hauri, Art. 66 Rz. 8, sowie Flachsmann et. al, Rz. 602 ff. Eine Zwangsanwendung oder die Möglichkeit zur zwangsweisen Vollstreckung des Befehls ist nicht vorausgesetzt. Ebenso bei der Rechtsbeugung. Sie erfasst elementare Verstösse gegen die Rechtspflege sowie Fälle, in denen sich die Amtsperson in schwerwiegender Weise von Recht und Gesetz entfernt und ihr Handeln als Organ des Staates statt an Recht und Gesetz an ihren eigenen Massstäben ausrichtet.[31]Statt vieler: Entscheid des deutschen Bundesgerichtshofs (BGH) 4 StR 83/20 vom 21. Januar 2021, m.w.H. Interessanterweise kennt das MStG für die Angehörigen der Armee und des Grenzwachtkorps (GWK)[32]Der Einfachheit halber wird der Begriff des «Grenzwachtkorps» verwendet, obschon diese Organisationseinheit, wie sie noch in Art. 3 Abs. 1 Ziff. 6 MStG erwähnt wird, nicht mehr existiert. Vgl. … Continue reading keinen analogen Tatbestand zu Art. 312 StGB. Für ein Verfahren wegen Amtsmissbrauchs durch Angehörige der Armee oder des GWK muss jeweils eine Einzelermächtigung erteilt werden.[33]Art. 219 Abs. 2 MStG. Zuständig für die (Selbst)Ermächtigung ist gemäss Art. 101a Abs. 1 der Verordnung über die Militärstrafrechtspflege vom 24. Oktober 1979 (MStV, SR 322.2) der … Continue reading
In der Lehre wird Zwang als direkte Einwirkung gegen Personen oder Sachen durch eine Behörde zur Durchsetzung einer gesetzlichen Pflicht beschrieben[34]Tiefenthal, 304, m.w.H. und damit als Eingriff in persönliche Freiheitsrechte verstanden.[35]Donatsch/Thommen/Wohlers, 552; BSK StGB-Heimgartner, Art. 312 Rz. 8. Im polizeilichen Kontext ist insbesondere an die Schutzbereiche von Art. 10, 13–17, 22 und 26 BV[36]Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (BV, SR 101). sowie die verwandten Bestimmungen der EMRK[37]Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten vom 4. November 1950 (EMRK, SR 0.101). zu denken. Bei der polizeilichen Zwangsanwendung geht es oft um a) unmittelbar physisches Einwirken auf Personen, Sachen oder Daten[38]Bezüglich Daten vgl. Art. 100 Abs. 1 Bst. c Bundesgesetz über die Armee und die Militärverwaltung vom 3. Februar 1995 (MG, SR 510.10) und Art. 37 Bundesgesetz über den Nachrichtendienst vom … Continue reading sowie b) die vorübergehende Einschränkung von aa) Freiheiten (bspw. durch Festnahme, usw.) oder bb) der Zugriffsmöglichkeit bzw. Verfügungsgewalt (bspw. Sicherstellung, Beschlagnahme). Unbestritten ist, dass die Anwendung physischen Zwangs durch Angehörige der Polizei Amtsgewalt darstellt und von Art. 312 StGB abgedeckt ist.[39]BGE 127 IV 209 E. 1 S. 210 ff.; BGE 104 IV 22 E. 2 S. 23; Urteil des Bundesgerichts 6B_649/2009 vom 16. Oktober 2009 E. 2. Anders fehlt es gemäss Bundesgericht beim zweckentfremdeten und damit widerrechtlichen Zugriff auf eine Datenbank (hier das Polizei-Informationssystem POLIS) an der Amtsgewalt i.S.v. Art. 312 StGB.[40]Urteile des Bundesgerichts 6B_825/2019 sowie 6B_845/2019 vom 6. Mai 2021 E. 7.4. ff. Wurde Zwang verfügt, aber noch nicht vollzogen, so wäre ein Versuch zu prüfen. Soweit gegen eine noch nicht vollstreckte Verfügung ein ordentliches Rechtsmittel eingelegt werden kann, ist aber Zurückhaltung geboten. Es sei nicht Zweck des Gesetzes, in fast allen Fällen den verwaltungsrechtlichen Schutz durch einen strafrechtlichen zu überlagern, formulierte es etwa das Bundesstrafgericht.[41]Urteil des Bundesstrafgerichts SK.2015.35 vom 10.11.2015 E. 2.3.2. Das Strafrecht soll ultima ratio bleiben.
Die Legitimation, Zwang anzuwenden, findet ihre Grundlage in zahlreichen spezialgesetzlichen Bestimmungen wie den kantonalen Polizeigesetzen, dem Zwangsanwendungsgesetz (Art. 5 ff. ZAG)[42]Bundesgesetz über die Anwendung polizeilichen Zwangs und polizeilicher Massnahmen im Zuständigkeitsbereich des Bundes vom 20. März 2008 (ZAG, SR 364). i.V.m. einem Spezialgesetz,[43]Beispielsweise Art. 100 ff. des Zollgesetzes vom 18. März 2005 (ZG, SR 631.0), Art. 22 und Art. 23r des Bundesgesetzes über die Massnahmen zur Wahrung der inneren Sicherheit vom 21. März … Continue reading dem Militärgesetz (Art. 92 f. und 100 MG),[44]Wobei für Mitarbeitende der Militärverwaltung sowie während des Assistenzdienstes das ZAG Anwendung findet; kritisch dazu Imhof, 153. der Strafprozessordnung (Art. 200 StPO),[45]Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (StPO, SR 312.0). dem Strafgesetzbuch (Art. 69 Abs. 2 StGB), dem Militärstrafprozess (Art. 54a f. MStP), dem Strassenverkehrsgesetz (Art. 54 SVG)[46]Strassenverkehrsgesetz vom 19. Dezember 1958 (SVG, SR 741.01). usw. Teilweise kann diese Befugnis privaten Sicherheitsdienstleistern übertragen werden. Dies ist beispielsweise im Ordnungsbussenbereich,[47]Vgl. Art. 2 Abs. 1 des Ordnungsbussengesetzes vom 18. März 2016 (OBG, SR 314.1); kritisch zur Möglichkeit der Sicherstellung und Einziehung nach Art. 8 OBG durch private … Continue reading im öffentlichen Verkehr,[48]Art. 5 Abs. 3 BGST. beim Schutz von Personen und Gebäuden[49]Art. 22 Abs. 2 BWIS. oder beim frisking an Sportveranstaltungen[50]Art. 3b Abs. 2 Konkordat über Massnahmen gegen Gewalt anlässlich von Sportveranstaltungen (für den Kanton Zürich: Gesetz über den Beitritt zum Konkordat über Massnahmen gegen Gewalt … Continue reading vorgesehen. Auch dieser Zwang bleibt Amtsgewalt.
Damit der Zwang tatsächlich als Amtsgewalt i.S.v. Art. 312 StGB gilt, muss der Täter gemäss Bundesgericht kraft seines Amtes, in Ausübung seiner hoheitlichen Gewalt, eine Massnahme treffen.[51]BGE 127 IV 209 E. 1 S. 210, m.w.H. Nur wer als Amtsperson gegen aussen resp. gegenüber potentiellen Geschädigten auftritt und Zwang ausübt, vermag das geschützte Rechtsgut zu verletzen.[52]Vgl. dazu etwa sinngemäss Stratenwerth/Bommer, § 59 Rz. 9. Dies darf etwa dann vermutet werden, wenn eine Amtsperson uniformiert auftritt.[53]Vgl. etwa § 18 Abs. 2 erster Satz des Gesetzes über die Kantonspolizei des Kantons Solothurn vom 23. September 1990 (PolG/SO; BGS 511.11) mit dem Sachtitel «Uniform/Legitimation», wonach bei … Continue reading Folgerichtig ist das unbefugte Tragen der Uniform verboten und wird – jedenfalls vereinzelt – unter Strafe gestellt.[54]Siehe die Übertretungstatbestände für das unbefugte Tragen der Polizeiuniform wie §8 Abs. 1 des Gesetzes des Kantons Basel-Landschaft über das kantonale Übertretungsstrafrecht vom 21. April … Continue reading Die Amtsperson, welche hingegen sichtlich als Privatperson auftritt und Zwang anwendet, übt keine Amtsgewalt i.S.v. Art. 312 StGB aus. Ihr Verhalten ist nach den Bestimmungen von Art. 111 ff. StGB zu würdigen.
Nach dem Gesagten dürfte Art. 312 StGB überwiegend auf Angehörige der Polizei, aber vereinzelt auch auf Hilfskräfte sowie beliehene private Sicherheitsdienstleister Anwendung finden. Aufgrund der umfassenden Legitimation, Zwang anzuwenden, werden sie für die Vollstreckung von Verfügungen und Realakten (bspw. des Lebensmittelinspektorats, der Baupolizei oder der Staatsanwaltschaft) beauftragt.[55]Häfelin/Müller/Uhlmann, Rz. 1465 ff. «Exekutorische Sanktionen» und insb. Rz. 1478 ff.; Albertini, Art. 23 Rz. 1 ff. Sie stehen damit im Fokus der Strafuntersuchung. Dabei ist nicht ausgeschlossen, dass sich auch die im Hintergrund verfügende Amtsperson (bspw. Lebensmittelinspektor oder Staatsanwältin) durch die in der Verfügung angeordnete (Zwangs‑)Massnahme nach Art. 312 StGB strafbar macht; bspw. bei der rechtswidrig angeordneten Versiegelung eines Restaurants oder der rechtswidrig angeordneten Beschlagnahme von Gegenständen. Die vollstreckenden Angehörigen der Polizei agieren in diesen Fällen nur als Tatmittler, soweit für sie die Widerrechtlichkeit nicht augenfällig war.[56]CR CP-Postizzi, Art. 312 Rz. 32. Es stellt sich hier die dornenvolle Frage, ab wann ein Handeln auf Befehl von der Strafe befreit; vgl. hierzu generell Art. 20 MStG sowie im Zusammenhang mit dem … Continue reading
Wer keine Amtsgewalt, sondern lediglich Amtspflichten missbraucht, macht sich u.U. der Begünstigung (Art. 305 StGB), der ungetreuen Amtsführung (Art. 314 StGB) oder der Widerhandlung gegen das Korruptionsstrafrecht (Art. 322ter ff. StGB) strafbar.[57]Donatsch/Thommen/Wohlers, 550. Auch ist eine rein personalrechtliche Massnahme vorstellbar (vgl. Ziff. IX.).[58]BSK StGB-Heimgartner, Art. 312 Rz. 21.
3. Tathandlung «missbrauchen»
Die Wortwahl lässt an ein qualifiziertes Tun oder Unterlassen denken. Gemäss Bundesgericht macht sich aber bereits strafbar, wer die Machtbefugnisse, die ihm sein Amt verleiht, unrechtmässig anwendet, d.h. kraft seines Amtes verfügt oder Zwang ausübt, wo es nicht geschehen dürfte.[59]BGE 127 IV 209 E. 1.a S. 211 ff.; Urteil des Bundesgerichts 1C_446/2021 vom 24. März 2022 E. 5.3. Die Strafbehörden haben somit zu prüfen, ob eine Amtshandlung im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen erfolgt ist, d.h. objektiv rechtens war. Bei dieser Überprüfung sind die gleichen Massstäbe wie im Verwaltungsrecht anzusetzen, um widersprechende Urteile zu vermeiden. Die individuelle strafrechtliche Verantwortung einer Amtsperson entscheidet sich häufig erst beim subjektiven Tatbestand, namentlich der Vor- bzw. Nachteilsabsicht.
Bei der Beurteilung der Amtshandlung ist strikt auf die ex-ante-Sicht abzustellen. Massgebend ist, über welche Informationen eine Amtsperson zum Zeitpunkt der Amtshandlung verfügte, wie sie die Gefahr für sich und Dritte einschätzte und die Aufgabenerfüllung gewichtete.
Amtsmissbrauch kann auch durch Unterlassen begangen werden,[60]BSK StPO-Heimberg, Art. 312 Rz. 18; CR CP-Postizzi, Art. 312 Rz. 27; PK StGB-Trechsel/Vest, Art. 312 Rz. 2. wenn etwa einer Person weiterhin die Freiheit entzogen wird, obschon die gesetzlichen Voraussetzungen nicht mehr erfüllt sind (beispielsweise Beugehaft).
Eine besondere Stellung nimmt das Verbot erniedrigender und unmenschlicher Behandlung sowie der Folter ein (Art. 10 Abs. 3 BV, Art. 3 EMRK). Diese notstandsfesten Garantien können unter keinen Umständen eingeschränkt werden.[61]Vgl. statt vieler OK BV-Heri, Art. 10 Rz. 86. Erfüllt eine polizeiliche Handlung die Kriterien von Art. 10 Abs. 3 BV, ist auch der objektive Tatbestand von Art. 312 StGB erfüllt. Beispielhaft ist etwa ein Vorfall zu nennen, bei welchem ein Polizist die vorläufig festgenommene Person am Nacken packte, zu Boden drückte und diese anschliessend mehrere Male gezielt durch eine Urinpfütze zog.[62]Sachverhalt gemäss Urteil des Obergerichts des Kantons Bern vom 28. Juni 2016, SK 15 378-380.
a) Rechtliche Grundlage (Art. 5 Abs. 1 bzw. Art. 36 Abs. 1 BV)[63]In aller Regel ist die Zwangsanwendung mit einem Eingriff in Grundrechte verbunden, womit die Voraussetzungen nach Art. 36 BV bzw. der EMRK zu prüfen sind.
Die Strafbehörde hat in einem ersten Schritt zu prüfen, ob die spezialgesetzlichen Bestimmungen für die gegenständliche Amtshandlung erfüllt waren. Nach hier vertretener Auffassung kann dies nicht nur eine reine Anwendungskontrolle beinhalten, sondern muss auch die Überprüfung der erforderlichen Normstufe[64]Polizeibefugnisse sind in aller Regel umfassend in einem Gesetz im formellen Sinne zu erlassen (vgl. statt vieler BGE 128 I 327 E. 4 S. 337 ff.). Prominente Ausnahmen finden sich in der … Continue reading und -dichte[65]Aber BGE 128 I 327 S. 339 E. 4.2: «Für das Polizeirecht stösst das Bestimmtheitserfordernis wegen der Besonderheit des Regelungsbereichs auf besondere Schwierigkeiten», weshalb auch relativ … Continue reading sowie die Vereinbarkeit mit übergeordnetem Recht umfassen. In Ausnahmefällen kann als Grundlage die polizeiliche Generalklausel dienen.[66]BGE 147 I 161 E. 5.1 S. 165 f.
In einem zweiten Schritt sind die rechtlichen Voraussetzungen für die konkrete Zwangsanwendung zu prüfen, welche bei der Vollstreckung der Amtshandlung erfolgte. Dabei ist zu untersuchen, ob die Amtsperson örtlich und sachlich zur Zwangsanwendung legitimiert war[67]Dabei sind an die eingeschränkten Befugnisse von Sicherheitsassistentinnen zu denken. und sie das Zwangsmittel rechtmässig eingesetzt hat; bspw. ob dem Schusswaffeneinsatz ein Warnruf vorausging[68]Tiefenthal, 366; wobei es sich beim Warnruf eigentlich um ein milderes Mittel zum Waffeneinsatz handelt, so auch Donatsch/Keller, §17 Rz. 81. oder verbotene Techniken wie die Behinderung der Atemwege angewendet wurden.[69]Beispielsweise Art. 13 ZAG.
Massgebend für die strafrechtliche Würdigung sind einzig die entsprechenden Gesetze und Verordnungen. Darunter fallen jedoch nicht Dienstbefehle (Verwaltungsverordnungen),[70]Frey/Omlin, 87. Ausbildungsunterlagen usw.[71]Diese können bei der Beurteilung von Sorgfaltspflichten eines mit zu beurteilenden Fahrlässigkeitsdelikts (insb. Art. 117 StGB oder Art. 125 StGB) an Relevanz gewinnen. So bleibt etwa ein polizeilicher Gewahrsam oder eine Hausdurchsuchung rechtmässig, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt waren, auch wenn die Polizistin entgegen ihrem Dienstbefehl die Zustimmung beim Pikettoffizier oder der Staatsanwältin zuvor nicht eingeholt hatte.[72]In die gleiche Richtung: BSK StGB-Heimgartner, Art. 312 Rz. 58; Frey/Omlin, 87. Solche internen Verfehlungen sind personalrechtlich zu ahnden.
b) Öffentliche Interessen und Schutz Grundrechte Dritter (Art. 5 Abs. 2 bzw. Art. 36 Abs. 2 BV)
In der Praxis leiten sich die öffentlichen Interessen und der Grundrechtsschutz meist unmittelbar aus dem Aufgabenkatalog in den Polizeigesetzen und weiteren Spezialerlassen ab. Diese Aufgaben können in sicherheits- und gerichtspolizeiliche unterschieden werden. Nicht vom öffentlichen Interesse gedeckt sind etwa die Misshandlung von Gefangenen aus blossem Sadismus[73]Beispiel von Stratenwerth/Bommer, § 59 Rz. 9. oder andere Eigeninteressen.
c) Verhältnismässigkeit (Art. 5 Abs. 2 bzw. Art. 36 Abs. 3 BV)
Gemäss ständiger bundesgerichtlicher Rechtsprechung liegt ein Amtsmissbrauch auch vor, wenn der Einsatz des Machtmittels zwar rechtmässig gewesen ist, hierbei das erlaubte Mass an Zwang jedoch überschritten wurde.[74]Urteil des Bundesgerichts 6B_391/2013 vom 27. Juni 2013 E. 1.3; so auch die Lehre: Frey/Omlin, 87, BSK StGB-Heimgartner, Art. 312 Rz. 11 f., und CR CP-Postizzi, Art. 312 Rz. 25. Gemeint ist die Verhältnismässigkeit: Eignung, Erforderlichkeit und Zumutbarkeit.
Die Eignung einer Zwangsmassnahme stellt für sich selten ein Problem dar. Sie entfällt nur dort, wo überhaupt kein belastbarer Erfolg zu erwarten ist. Beispiel: Die beschuldigte Person wird während der Einvernahme geschlagen, um Informationen zu gewinnen.[75]Beispiel angelehnt an Pajarola, 264.
Bereits schwieriger ist die Frage der Erforderlichkeit zu beantworten. Zwar gibt es Fälle, in denen sie offensichtlich verneint werden kann. So etwa das Bundesgericht: «Zur Verfolgung des Zwecks, den Beschwerdegegner anzuhalten und auf den Polizeiposten zu führen, hätte der Beschwerdeführer ihn direkt auf den Boden bringen können. Der wuchtige Stoss mit dem Kopf voran in die Klingelanlage war dazu nicht erforderlich».[76]Urteil des Bundesgerichts 6B_1212/2018 vom 5. Juli 2019 E. 2.4. Vielfach sind die Konstellationen weniger klar. Es geht etwa um die Wahl des mildesten, gleich geeigneten Zwangsmittels und dessen Einsatz (Technik). Beispiel: körperlicher Zwang, Diensthund, Schlagstock, Destabilisierungsgerät (DSG), Reizstoffspray (RSG), Munition (Deformationsgeschoss,[77]Kneubuehl et al., 106, 108 und 112. Gummigeschoss)[78]Willmann, 22–27., Wasserwerfer mit/ohne Reizstoffzusatz usw. Diese Fragen lassen sich im breiten Aufgabengebiet der Polizei oft nicht abstrakt klären, auch wenn im Rahmen der Ausbildung (zurecht) ein schematisches Vorgehen gelehrt wird. Den Einsatzkräften ist daher ein grosser Ermessensspielraum einzuräumen. Gleichzeitig gewinnt die Frage der Angemessenheit hinsichtlich personalrechtlicher Verfahren an Bedeutung.
Dreh- und Angelpunkt ist die Überprüfung der Zumutbarkeit (Verhältnismässigkeit i.e.S.). Die Strafbehörde muss sich die Frage stellen, ob dem Rechtsgutträger zugemutet werden konnte, die Zwangsmassnahme über sich ergehen zu lassen und auf sein Rechtsgut zu verzichten bzw. das Risiko für sein Rechtsgut hinzunehmen. Hier wird verkürzt auch von der Zweck-Mittel-Relation gesprochen.[79]Statt vieler BGE 142 II 1 E. 2.3 S. 4 f. Beim Zweck (Auftrag) sind insbesondere die vom Störer ausgehende Gefahr sowie die angeblich begangenen Delikte zu berücksichtigen. Bei der Gefahr sind das Ausmass und die Nähe der Realisierung massgebend. Bei den angeblich begangenen Delikten ist auf das bedrohte Rechtsgut sowie die zu erwartende Sanktion abzustellen. Beispiel: Das öffentliche Interesse an der Strafverfolgung bei einer Übertretung gegen das BetmG[80]Bundesgesetz über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe vom 3. Oktober 1951 (BetmG, SR 812.121). durch eine abhängige Person wiegt deutlich kleiner als bei einer Kindesentführung. Diesem Zweck sind die eingesetzten Zwangsmittel gegenüberzustellen. Hier sind insbesondere die Wahl des Zwangsmittels und dessen Einsatz (Technik) und damit die Gefährdung oder Verletzung des Rechtsguts zu berücksichtigen. Mit Blick auf den Zweck (Auftrag) darf das gewählte Mittel weder per se zu intensiv sein noch (beispielsweise zeitlich) zu extensiv eingesetzt werden. Dabei sind sowohl die unmittelbaren als auch die mittelbaren Folgen für den Rechtsgutträger zu berücksichtigen; beispielsweise die Gefahr eines Ricochets oder von Infektionen bei einem Biss eines Diensthundes oder die Möglichkeit, in der konkreten Lage Nachsorge zu leisten.[81]Vgl. etwa die Verpflichtung in Art. 136 PolG/BE oder Art. 22 ZAG; zum Hundebiss vgl. Urteil des Bundesgerichts 6B_899/2018 vom 2. November 2018 E. 2.2. Kritisch ist auch die Schussabgabe auf Reifen zu betrachten, da die Luft in der Regel nicht derart rasch entweicht, dass die flüchtige Person unvermittelt an der Weiterfahrt gehindert wird und vielmehr das Unfallrisiko unkontrolliert wächst.
Aus dem Verhältnismässigkeitsprinzip leitet sich schliesslich die Verpflichtung ab, dass sich eine polizeiliche Massnahme grundsätzlich nur gegen den Störer richten darf (sog. Störerprinzip).[82]BGE 147 I 161 E. 6 S. 168 ff. Das Störerprinzip verlangt aber weder eine Rechtswidrigkeit noch ein Verschulden des Störers.[83]Urteil des Bundesgerichts 2C_1096/2016 vom 18. Mai 2018 E. 2.4.
d) Kerngehalt (Art. 36 Abs. 4 BV)
Die Kerngehalte der einzelnen Grundrechte geniessen absoluten Schutz und dürfen nicht verletzt werden. Dies gilt auch für Angehörige der Polizei. Vorstellbar ist aber eine Pflichtenkollision, wenn die Polizei eine Kerngehaltsverletzung durch einen Störer abwenden will, dies aber nur durch eine Kerngehaltsverletzung beim Störer selbst gelingt.[84]Vgl. dazu auch Mohler, Grundzüge, 113 m.w.H.
VI. Subjektiver Tatbestand
Art. 312 StGB verlangt Vorsatz, wobei Eventualvorsatz genügt. Gemäss Bundesgericht entfällt der Vorsatz, wenn die Amtsperson im Glauben handelte, sie übe ihre Machtbefugnisse pflichtgemäss aus.[85]Urteil des Bundesgerichts 1C_175/2021 vom 16. Januar 2021 E. 5.2.1. Dieser Argumentation ist zurückhaltend zu folgen. Sie trifft zu, wenn im Verfahren festgestellt wird, dass eine gesetzliche Grundlage mit übergeordnetem Recht kollidiert und schliesslich fehlt. Das polizeiliche Handeln war also objektiv widerrechtlich, kann der beschuldigten Person aber strafrechtlich nicht angelastet werden.
Die Amtsperson muss ausserdem in der Absicht handeln, sich oder einem Dritten einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen oder einem anderen einen unrechtmässigen Nachteil zuzufügen. Eventualabsicht genügt.[86]BGer 1C_175/2021 E. 5.2.1; PC CP-Dupuis et al., Art. 312 Rz. 26. Das Bundesgericht erkennt einen solchen Nachteil bereits in der Anwendung von unrechtmässigem Zwang.[87]BGE 149 IV 128 E. 1.3 S. 131 ff. m.w.H. Nach hier vertretener Ansicht ist die besondere Absicht in Art. 312 StGB restriktiv auszulegen. Es soll nur strafbar sein, wenn eine selbständige Vor- oder Nachteilsabsicht der Amtsperson vorliegt, d.h. diese gezielt ausserhalb des gesetzlichen Auftrags handelte. Andernfalls verliert dieses subjektive Tatbestandselement beim Einsatz von polizeilichem Zwang seine eigenständige Bedeutung[88]Stratenwerth/Bommer, § 59 Rz. 12, bemerken zurecht, dass das Absichtserfordernis dem Tatbestand keine schärfere Kontur verleiht; so auch Donatsch/Thommen/Wohlers, 554; kritisch zur … Continue reading und entspricht nicht der Intention des historischen Gesetzgebers.[89]Botschaft des Bundesrates vom 23. Juli 1918 an die Bundesversammlung zu einem Gesetzesentwurf enthaltend das schweizerische Strafgesetzbuch, BBl 1918 IV 1, 65: «Die Verletzung der allgemeinen … Continue reading
Der Vor- bzw. Nachteil kann materieller oder immaterieller Natur sein. Die Lehre nennt beispielhaft eine öffentlichkeitswirksame Verhaftung, um bei der verhafteten Person massiven Ärger auszulösen,[90]Stratenwerth/Bommer, § 59 Rz. 12. um ihr einen Denkzettel zu verpassen, einen Arbeitsplatzverlust zu erwirken, familiäre Beziehungen zu ruinieren, ihr Ansehen zu schädigen[91]Frey/Omlin, 84. oder sie im Hinblick auf eine Befragung zu verunsichern.[92]BSK StGB-Heimgartner, Art. 312 Rz. 23; AK StGB-Wyler/Michlig, Art. 312 Rz. 11.
VII. Rechtfertigungsgründe
Der Rechtfertigungsgrund gesetzlich erlaubte Handlung (Art. 14 StGB) ist bereits im objektiven Tatbestand von Art. 312 StGB enthalten. Er hat keine eigenständige Bedeutung. Weitergehende Rechtfertigungsgründe wie Notwehr(hilfe) oder Notstands(hilfe) bleiben jedoch vorbehalten.[93]BSK StGB-Heimgartner, Art. 312 Rz. 25.
VIII. Konkurrenz und Abgrenzung
Echte Konkurrenz besteht zwischen Art. 312 StGB und den Delikten gegen Leib und Leben (insb. Art. 111 ff. und 122 ff. StGB)[94]BGE 99 IV 13 E. 3 S. 14. sowie Drohung (Art. 180 StGB) und Freiheitsberaubung (Art. 183 StGB). Die Nötigung (Art. 181 StGB) wird hingegen von Art. 312 StGB konsumiert.[95]BSK StGB-Heimgartner, Art. 312 Rz. 25; PK StGB-Trechsel/Vest, Art. 312 Rz. 10; AK StGB-Wyler/Michlig, Art. 312 Rz. 15; CR CP-Postizzi Art. 312 Rz. 36; PC CP-Dupuis et al., Art. 312 Rz 27; … Continue reading Die Amtsanmassung (Art. 287 StGB) kann denklogisch nicht mit Art. 312 StGB konkurrieren, da Letzterer tatsächliche Amtsgewalt voraussetzt («ihre Amtsgewalt»), welche bei Art. 287 StGB fehlt.[96]Gemäss PK StGB-Trechsel/Vest, Art. 312 Rz. 10, gilt Alternativität: «bei Amtsmissbrauch geht es um Amtsgewalt, die dem Täter wirklich zusteht, bei Amtsanmassung wird Macht usurpiert»; ebenso … Continue reading
Für den Konsulats- oder Botschaftsschutz[97]Beispielsweise im Kanton Zürich, wo Hilfskräfte gemäss ZAG agieren. und die Kontrolle des ruhenden Verkehrs[98]Vgl. etwa Art. 156 Abs. 1 PolG/BE «Polizeistatus». Gemäss Vortrag des Regierungsrates zum PolG/BE, S. 70 unten, wird mit dem Polizeistatuts die Kompetenz, Zwang anzuwenden, verliehen. werden regelmässig Hilfskräfte, sog. Sicherheitsassistentinnen, eingesetzt. Diese Hilfskräfte verfügen je nach spezialgesetzlicher Regelung über keine[99]Vgl. etwa §5 Abs. 2 Polizeiorganisationsgesetz des Kantons Zürich vom 29. November 2004 (LS 551.1; POG/ZH). oder nur eingeschränkte[100]Vgl. etwa §18ter Abs. 3 PolG/SO. Befugnisse, Zwang anzuwenden. Soweit diese zur Vornahme von Amtshandlungen und deren zwangsweisen Vollstreckung befugt sind, ist ihr Handeln stets unter Art. 312 StGB zu prüfen – auch wenn die Amtshandlung bzw. die zwangsweise Vollstreckung krass unverhältnismässig war. War die Hilfskraft überhaupt nicht zur konkreten Amtshandlung und deren zwangsweisen Vollstreckung legitimiert, so bleibt die Amtsanmassung zu prüfen.[101]Komm. PolG-Plüss, Vorbemerkungen zu §§59a–59j Rz. 84 ff. Dasselbe gilt für Mitarbeitende von beliehenen privaten Sicherheitsdienstleistern.
Fiskal- und Korruptionstatbestände stehen in der Regel aufgrund der unterschiedlichen Rechtsgüter in echter Konkurrenz zu Art. 312 StGB.[102]BSK StGB-Heimgartner, Art. 312 Rz. 25 f.; PK StGB-Trechsel/Vest, Art. 312 Rz. 10, m.w.H. und einer differenzierten Übersicht.
IX. Auswirkung von Art. 312 StGB
1. … auf weitere Anklagepunkte
Ist der objektive Tatbestand von Art. 312 StGB nicht erfüllt, d.h. wird die Amtshandlung als rechtens bestätigt, haben gestützt auf Art. 14 StGB auch für die weiteren, in diesem Zusammenhang stehenden Anklagepunkte Freisprüche zu erfolgen. Dabei handelt es sich meist um Delikte gegen Leib und Leben oder die Freiheit. Methodisch bildet Art. 312 StGB daher den Ausgangspunkt für die strafrechtliche Überprüfung eines Polizeieinsatzes.[103]Frey/Omlin, 88, erblicken in der Praxis gerade die umgekehrte Vorgehensweise.
2. … auf personalrechtliche Verfahren (Disziplinarrecht)
Da die Strafbehörden über keine volle Kognition verfügen, ist selbst bei einem Freispruch eine personalrechtliche Massnahme vorstellbar, sollte das Verhalten unangemessen gewesen oder ein Dienstbefehl verletzt worden sein. In der Praxis wird mit dem personalrechtlichen Verfahren meist bis zum Abschluss des Strafverfahrens zugewartet.[104]Ebenso die Wahrnehmung von Frey/Omlin, 84, wobei diese Tendenz möglicherweise auf Art. 18 Abs. 2 des Bundesgesetzes über die Verantwortlichkeit des Bundes sowie seiner Behördenmitglieder und … Continue reading Dies womöglich mit der Absicht, die beschuldigte Person nicht bereits personalrechtlich «vorzuverurteilen».[105]Für Angehörige der Armee hat das Militärkassationsgericht in ständiger Rechtsprechung entschieden, dass eine Disziplinarmassnahme nicht gegen das Doppelbestrafungsverbot verstösst, da diese … Continue reading U.U. ist eine umgehende personalrechtliche Massnahme sinnvoll, beabsichtigt das Polizeikommando unmittelbar zu reagieren und zeigen zu wollen, dass ein bestimmtes Verhalten nicht geduldet wird.[106]Vgl. Flachsmann et al. für Disziplinarmassnahme von Angehörigen der Armee, Rz. 811. Solche personalrechtlichen Massnahmen sind im nachgelagerten Strafverfahren bei der Strafzumessung zu berücksichtigen.[107]BSK StGB-Wiprächtiger/Keller, Art. 47 Rz. 161; ebenso Flachsmann et al., Rz. 196. Ein hängiges personalrechtliches Verfahren kann, wie das Strafverfahren selbst, in der täglichen Arbeit von Angehörigen der Polizei verunsichern und hemmend wirken. Es ist daher angezeigt, diese Verfahren möglichst rasch voranzutreiben.
3. … auf die Staatshaftung[108]Für einen generellen Überblick zur Staatshaftung bei polizeilichem Handeln siehe Sutter, passim, Magnin, passim sowie Selle, passim.
Bei Forderungen aus Staatshaftung handelt es sich um öffentlich-rechtliche Ansprüche. Sie können daher im Strafverfahren nicht adhäsionsweise geltend gemacht werden.[109]Vgl. statt vieler BGE 146 IV 76 E. 3.1 S. 82 f. Ein Urteil einer Strafbehörde bildet aber einen Orientierungspunkt für das Verwaltungsverfahren wegen Staatshaftung. Für Ansprüche aus Staatshaftung genügt es, wenn die Strafbehörden den objektiven Tatbestand als erfüllt erachtet haben. Der subjektive Tatbestand braucht hingegen nicht erfüllt zu sein und ist nur bei internen Regressansprüchen richtungsweisend. Ausnahmsweise ist auch bei einem Freispruch mangels objektiven Tatbestands ein Verfahren wegen Staatshaftung denkbar, sofern die Amtshandlung unangemessen war bzw. ein Sonderopfer vorliegt.[110]Zur Haftung für rechtmässige Schädigung siehe Gross/Pribnow, 26 f., sowie Jaag, 52 ff.
X. Schlussbemerkung
Die sorgfältige und unabhängige Aufarbeitung von Polizeieinsätzen ist essentiell, um das Vertrauen der Bevölkerung und die Glaubwürdigkeit der staatlichen Institutionen zu wahren. Die Strafunteruntersuchung ist nur ein Instrument hierfür, aber wohl das am häufigsten angewendete und jenes mit der grössten medialen Wirkung. Die Strafbehörden bewegen sich dabei an der Schnittstelle zwischen Strafrecht und klassischem Verwaltungsrecht. Diese verwaltungsrechtliche Optik ist für die Strafbehörden häufig fremd und somit herausfordernd. Umso wichtiger erscheint es, das Bewusstsein für die Schnittstelle und die Fernwirkung auf andere Rechtsgebiete zu schärfen. Nicht zuletzt deswegen sollte die Beurteilung einer zwangsweise vollstreckten Amtshandlung, unabhängig davon, ob sie von einem Verwaltungsgericht oder den Strafbehörden vorgenommen wird, zum selben Resultat führen. M.a.W. müssen dieselben Massstäbe gelten. Letztendlich entscheidet sich die individuelle Strafbarkeit der Angehörigen der Polizei häufig erst beim subjektiven Tatbestand. Angesichts dessen verdient die Vor- bzw. Nachteilsabsicht, oder eben «Missbrauchsabsicht», eine eigenständige Bedeutung. Sie darf sich nicht mit dem Vorsatz decken. Überdies wären vermehrt transparente und unabhängige Administrativuntersuchungen wünschenswert, wenn Ereignisse zu untersuchen und interne Prozesse, Ausbildungen, Dienstbefehle usw. anzupassen sind, sofern keine Opfer existieren.
Literaturverzeichnis
Albertini Gianfranco, Polizeigesetz und Polizeiverordnung des Kantons Graubünden, 2. A., Zürich 2022.
Bodin Jean, Über den Staat, Reclam, Stuttgart 2011.
Donatsch Andreas/Jaag Tobias/Zimmerlin Sven (Hrsg.), PolG, Kommentar zum Polizeigesetz, Zürich, Zürich 2018 (zit.: Komm. PolG-Bearbeiter/in, Art. XX Rz. YY).
Donatsch Andreas/Thommen Marc, Wohler Wolfgang, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, 5. A., Zürich 2017.
Dupuis Michel et al. (Hrsg.), Petit Commentaire, Code pénal, 2. A., Basel 2017 (zit.: PC CP-Bearbeiter/in, Art. XX Rz. YY).
Ehrenzeller Bernhard et al., Die schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, 4. A., Zürich/St. Gallen 2023 (zit.: SGK BV-Bearbeiter/in, Art. XX Rz. YY).
Flachsmann Stefan et al., Disziplinarstrafordnung, Das militärische Disziplinarstrafrecht, 6. A., Zürich/St. Gallen 2022.
Frey Georges/Omlin Esther, Amtsmissbrauch – die Ohnmacht der Mächtigen, AJP 2005, S. 82–90.
Graf Damian K. (Hrsg.), Annotierter Kommentar StGB, Bern 2020 (zit.: AK StGB-Bearbeiter/in, Art. XX Rz. YY).
Gross Jost/Pribnow Volker, Schweizerisches Staatshaftungsrecht, Ergänzungsband zur 2. A., Bern 2013.
Häfelin Ulrich/Müller Georg/Uhlmann Felix, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8. A., Zürich/St. Gallen 2020.
Hauri Kurt, Militärstrafgesetz, Kommentar, Bern 1983.
Hobbes Thomas, Leviathan, Reclam, Stuttgart 2014.
Imhof Jan, Teilrevision der Polizeibefugnisse der Armee und Gruppe Verteidigung – Eine Weiterentwicklung?, suigeneris 2023, S. 151–158.
Jaag Tobias, Staats- und Beamtenhaftung, Band I, Teil 3, 3. A., Basel 2017.
Kley Andreas, Staatliches Gewaltmonopol – Ideengeschichtliche Herkunft und Zukunft, in: Lienemann Wolfgang/Zwahlen Sara (Hrsg.), Kollektive Gewalt, Kulturhistorische Vorlesung 2003/2004 des Collegium generale, Bern 2006.
Kneubuehl Beat P. et al., Wundballistik, 4. A., Berlin 2022.
Macaluso Alain/Moreillon Laurent/Queloz Nicolas (Hrsg.), Code pénal II, Commentaire Romand, Basel 2017 (zit.: CR CP-Bearbeiter/in, Art. XX Rz. YY).
Magnin Josianne, Die Polizei: Aufgabe, rechtsstaatliche Grenzen und Haftung, Diss. Zürich, 2017.
Moeckli Daniel, Sicherheitsverfassung, in: Diggelmann Oliver/Hertig Randall Maya/Schindler Benjamin (Hrsg.), Verfassungsrecht der Schweiz Bd. III, Zürich 2020.
Mohler Markus H.F., Grundzüge des Polizeirechts in der Schweiz, Basel 2012 (zit.: Mohler, Grundzüge).
Mohler Markus H.F., Polizeiberuf und Polizeirecht im Rechtsstaat, Bern 2020 (zit.: Mohler, Polizeiberuf).
Mohler Markus H.F., Staatliches Gewaltmonopol, Sicherheit&Recht 3/2012, S. 152-162 (zit.: Mohler, Gewaltmonopol).
Niggli Marcel Alexander/Wiprächtiger Hans (Hrsg.), Strafrecht II (StGB/JStGB), Basler Kommentar, 4. A., Basel 2018 (zit.: BSK StGB-Bearbeiter/in, Art. XX Rz. YY).
Pajarola Umberto, Gewalt im Verhör zur Rettung von Menschen, Diss. Zürich, 2007.
Rousseau Jean-Jaques, Vom Gesellschaftsvertrag oder Grundsätze des Staatsrechts, Reclam, Stuttgart 2011.
Schlegel Stefan/Ammann Odile (Hrsg.), Onlinekommentar zur Bundesverfassung (zit.: OK BV-Bearbeiter/in, Art. XX, Rz. YY).
Selle Andrea, Staatshaftung im Rahmen der Erfüllung sicherheitspolizeilicher Aufgaben durch Private, Risiko&Recht, 01/2021, S. 33-72.
Stratenwerth Günter/Bommer Felix, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II: Straftaten gegen Gemeininteressen, 7. A., Bern 2013.
Sutter Patrick, Staatshaftung für polizeiliches Handeln, in: Rütsche Bernhard/Fellmann Walter (Hrsg.), Aktuelle Fragen des Staatshaftungsrechts – Tagung vom 3. Juli 2014 Luzern, Bern 2014.
Tiefenthal Jürg Marcel, Kantonales Polizeirecht der Schweiz, Zürich 2018.
Trechsel Stefan/Pieth Mark (Hrsg.), Schweizerisches Strafgesetz, Praxiskommentar, 4. A., Zürich/St. Gallen 2021 (zit.: PK StGB-Bearbeiter/in, Art. XX Rz. YY).
Tschannen Pierre, Staatsrecht der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 5. A., Bern 2021.
Willmann Tim, Gummigeschosse im polizeilichen Ordnungsdienst – Rechtliche Qualifikation und Verhältnismässigkeit, Bern 2023.
Fussnoten[+]
| ↑1 | Beispiel: Oberholzer Niklaus, Bericht über die Abklärungen von Vorwürfen im Bereich der Sicherheit in den Bundesasylzentren, erstattet im Auftrag des Staatsekretariats für Migration (SEM) vom 30. September 202; Zur Administrativuntersuchung auf Bundesebene vgl. Art. 27a ff. der Regierungs- und Verwaltungsorganisationsverordnung vom 25. November 1998 (RVOV, SR 172.010.1). Bei Angehörigen der Armee oder des Grenzwachkorps besteht hingegen die Möglichkeit einer vorläufigen Beweisaufnahme durch die Militärjustiz, auch ohne strafbare Handlung (Art. 102 Abs. 2 Militärstrafprozess vom 23. März 1979 [MStP, SR 322.1]). |
|---|---|
| ↑2 | Vgl. auch Sturm Evelyne/Locher Reto/Künzli Jörg/Wyttenbach Judith, Umgang mit Beschwerden gegen die Stadtpolizei Zürich, Schweizerisches Kompetenzzentrum für Menschenrecht (SKMR), 28. Februar 2017. |
| ↑3 | Illustrativ die Richtlinienmotion 224-2023 im Grossen Rat des Kantons Bern mit dem Titel «Missbrauch durch Medien-Konzern: Kantonsangestellte schützen». |
| ↑4 | Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 (StGB, SR 311.0). |
| ↑5 | Für eine Übersicht vgl. Kley, passim, sowie Mohler, Gewaltmonopol, passim. |
| ↑6 | Bodin, Buch I, 8. Kapitel, Rz. 122. Vgl. auch 10. Kapitel, Rz. 216; Buch III, 4. Kapitel, Rz. 409, und 5. Kapitel passim; Buch IV, 1. Kapitel, Rz. 503. |
| ↑7 | Hobbes, 17. Kapitel, S. 155: «[Der] Staat ist eine Person, deren Handlung eine grosse Menge Menschenkraft der gegenseitigen Verträge eines jeden mit einem jeden als ihre eigenen ansehen, auf dass diese nach ihrem Gutdünken die Macht aller zum Frieden und zur gemeinschaftlichen Verteidigung anwenden.» |
| ↑8 | Locke, 2. Buch, 9. Kapitel, §130, S. 280: «Die zweite Gewalt, nämlich die Gewalt, gibt er [Anm.: der Bürger], vollständig auf und verpflichtet seine natürliche Kraft […], um die exekutive Gewalt der Gesellschaft zu unterstützen, so es das Gesetz verlangt». |
| ↑9 | BGE 148 II 218 E. 4.4 S. 225 m.w.H. |
| ↑10 | Moeckli, 2273. |
| ↑11 | Ausnahmen bilden namentlich Art. 44 Abs. 1 Constitution du Canton de Vaud vom 14. April 2003 (KV/VD, BLV 101.01): «Dans les limites de ses compétences, l’État détient le monopole de la force publique» und Art. 184 Abs. 1 Constitution de la République et canton de Genève vom 14. Oktober 2012 (KV/GE, A 2 00): «Le canton détient le monopole de la force publique». |
| ↑12 | Beispiel: Art. 12 Abs. 1 Polizeigesetz des Kantons Bern vom 10. Februar 2019 (PolG/BE, BSG 551.1) mit dem Sachtitel «Gewaltmonopol der Kantonspolizei» erklärt für die Anordnung und den Einsatz von polizeilichem Zwang die ausschliessliche Zuständigkeit der Kantonspolizei. Implizit auch § 27 Abs. 1 des Polizeigesetzes des Kantons Aargau vom 6. Dezember 2005 (PolG/AG, SAR 531.200), ebenfalls mit dem Sachtitel «Gewaltmonopol», wonach: «[d]ie Übertragung hoheitlicher polizeilicher Befugnisse an Private, insbesondere von polizeilichen Massnahmen und Zwangsmitteln […]» grundsätzlich nicht zulässig sei. |
| ↑13 | Exemplarisch: § 20 Abs. 1 des Gesetzes über die Luzerner Polizei vom 27. Januar 1998 (PolG/LU, SRL Nr. 350): «Die Luzerner Polizei kann zur Erfüllung ihrer Aufgaben unmittelbaren Zwang gegen Sachen und Personen anwenden und geeignete Hilfsmittel einsetzen» oder §18 Abs. 1 des Polizeigesetzes des Kantons Thurgau vom 9. November 2011 (PolG/TG, RB 551.1): «Zur Erfüllung ihrer Aufgaben darf die Kantonspolizei im Rahmen der Verhältnismässigkeit unmittelbaren Zwang gegen Personen, Tiere und Sachen anwenden». |
| ↑14 | Vorbehalten bleiben die Jedermannsrechte wie die Notwehr(hilfe), Notstands(hilfe), das allgemeine Festhalterecht oder der zivilrechtliche Besitzesschutz. |
| ↑15 | Tschannen, §5 Rz 13: «Dem Gewaltmonopol zugunsten des Staats entspricht als Kehrseite das Gewaltverbot und die Friedenspflicht zulasten der Bürger». |
| ↑16 | BSK StGB-Heimgartner, Art. 312 Rz. 4; PK StGB-Trechsel/Vest, Art. 312 Rz. 1; AK StGB-Wyler/Michlig, Art. 312 Rz. 1; CR CP-Postizzi, Art. 312 Rz. 5; Frey/Omlin, 83 f. |
| ↑17 | CR CP-Postizzi, Art. 312 Rz. 4: «Si le citoyen peut être l’objet de mesures de contrainte de la part de l’Etat, dans le même temps il doit avoir la possibilité d’exiger que les principes qui régissent l’activité étatique soient correctement appliqués. Il appartient principalement au droit administratif de classifier les tâches attribuées à l’Etat et de réglementer les modes d’exercice du pouvoir. Le droit pénal ne s’insère dans cet enchevêtrement constitutionnel qu’en tant que correctif (Machtkorrektiv). Il s’occupe dès lors de la ‹microphysique du pouvoir› selon Michel Foucault, dans les cas où l’autorité impose sa volonté de manière unilatérale en usant de son pouvoir de contrainte quant à la constitution, la modification, l’annulation de droits ou à la concrétisation d’actes matériels, situations dans lesquelles la personne physique se trouve dans un rapport de subordination». |
| ↑18 | Vgl. dazu die vorerwähnten Kommentatoren zu Art. 312 a.a.O. sowie explizit die Botschaft des Bundesrates vom 23. Juli 1918 an die Bundesversammlung zu einem Gesetzesentwurf enthaltend das schweizerische Strafgesetzbuch, BBl 1918 IV 1, 65: «Die Verletzung der allgemeinen Amtspflicht wird hauptsächlich da bedroht, wo sie in einer eigennützigen Ausbeutung der durch das Amt verliehenen Machtbefugnissen besteht […]. Die Strenge des Beamtenstrafrechts entspricht der grossen Bedeutung, die wir der Aufrechterhaltung des guten Rufes, den die Beamten unseres Landes bisher mit Recht genossen habe, beimessen». |
| ↑19 | Urteil des Bundesgerichts 6B_837/2018 vom 9. November 2018 E. 4.2. |
| ↑20 | BSK StGB-Heimgartner, Art. 312 Rz. 8. |
| ↑21 | BGE 129 IV 246 E. 2.3 S. 250. |
| ↑22 | BGE 141 IV 329 E. 1.3 S. 331. |
| ↑23 | Bundesgesetz über die Sicherheitsorgane der Transportunternehmen im öffentlichen Verkehr vom 18. Juni 2010 (BGST, SR 745.2). |
| ↑24 | Beschluss der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts BB.2022.83 vom 12. April 2023 E. 2.4. |
| ↑25 | A.M. BSK StGB-Heimgartner, Art. 312 Rz. 5, sowie AK StGB-Wyler/Michling, Art. 312 Rz. 3; ebenso Frey/Omlin, 84, und wohl auch CR CP-Postizzi, Art. 312 Rz. 20; vgl. aber auch PK StGB-Trechsel/Vest, Art. 312 Rz. 2, sowie PC CP-Dupuis, Art. 312 Rz 6, welche keine Einschränkung auf mit Gewalt ausgestattete Amtspersonen vornehmen. |
| ↑26 | Etwa verneint bei der Genehmigung einer Verteilungsliste und Schlussrechnung nach einem Bankenkonkurs; Urteil des Bundesstrafgerichts SK.2015.35 vom 10. November 2015 E. 2.3.2. |
| ↑27 | BSK StGB-Heimgartner, Art. 312 Rz. 4 mit Verweis auf BGE 88 IV 66 S. 69. |
| ↑28 | Militärstrafgesetz vom 13. Juni 1927 (MStG, SR 321.0). |
| ↑29 | Das deutsche Recht kennt selbstredend auch in §302 StGB/DE, Missbrauch der Amtsgewalt, ein Pendant zu Art. 312 StGB. |
| ↑30 | Hauri, Art. 66 Rz. 8, sowie Flachsmann et. al, Rz. 602 ff. |
| ↑31 | Statt vieler: Entscheid des deutschen Bundesgerichtshofs (BGH) 4 StR 83/20 vom 21. Januar 2021, m.w.H. |
| ↑32 | Der Einfachheit halber wird der Begriff des «Grenzwachtkorps» verwendet, obschon diese Organisationseinheit, wie sie noch in Art. 3 Abs. 1 Ziff. 6 MStG erwähnt wird, nicht mehr existiert. Vgl. dazu auch Beschluss der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts BG.2021.40 vom 2. Dezember 2021 E. 3. |
| ↑33 | Art. 219 Abs. 2 MStG. Zuständig für die (Selbst)Ermächtigung ist gemäss Art. 101a Abs. 1 der Verordnung über die Militärstrafrechtspflege vom 24. Oktober 1979 (MStV, SR 322.2) der Oberauditor. |
| ↑34 | Tiefenthal, 304, m.w.H. |
| ↑35 | Donatsch/Thommen/Wohlers, 552; BSK StGB-Heimgartner, Art. 312 Rz. 8. |
| ↑36 | Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (BV, SR 101). |
| ↑37 | Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten vom 4. November 1950 (EMRK, SR 0.101). |
| ↑38 | Bezüglich Daten vgl. Art. 100 Abs. 1 Bst. c Bundesgesetz über die Armee und die Militärverwaltung vom 3. Februar 1995 (MG, SR 510.10) und Art. 37 Bundesgesetz über den Nachrichtendienst vom 25. September 2015 (NDG, SR 121). |
| ↑39 | BGE 127 IV 209 E. 1 S. 210 ff.; BGE 104 IV 22 E. 2 S. 23; Urteil des Bundesgerichts 6B_649/2009 vom 16. Oktober 2009 E. 2. |
| ↑40 | Urteile des Bundesgerichts 6B_825/2019 sowie 6B_845/2019 vom 6. Mai 2021 E. 7.4. ff. |
| ↑41 | Urteil des Bundesstrafgerichts SK.2015.35 vom 10.11.2015 E. 2.3.2. |
| ↑42 | Bundesgesetz über die Anwendung polizeilichen Zwangs und polizeilicher Massnahmen im Zuständigkeitsbereich des Bundes vom 20. März 2008 (ZAG, SR 364). |
| ↑43 | Beispielsweise Art. 100 ff. des Zollgesetzes vom 18. März 2005 (ZG, SR 631.0), Art. 22 und Art. 23r des Bundesgesetzes über die Massnahmen zur Wahrung der inneren Sicherheit vom 21. März 1997 (BWIS, SR120), Art. 4 ff. des Bundesgesetzes über die Sicherheitsorgane der Transportunternehmen im öffentlichen Verkehr (BGST, SR 745.2), Art. 22a Abs. 3 des Bundesgesetzes über die Luftfahrt vom 21. Dezember 1948 (LFG. SR 748.0); Art. 9 des Asylgesetzes vom 26. Juni 1998 (AsylG, SR 142.31) oder Art. 70 ff. des Bundesgesetzes über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (AIG, SR 142.20). |
| ↑44 | Wobei für Mitarbeitende der Militärverwaltung sowie während des Assistenzdienstes das ZAG Anwendung findet; kritisch dazu Imhof, 153. |
| ↑45 | Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (StPO, SR 312.0). |
| ↑46 | Strassenverkehrsgesetz vom 19. Dezember 1958 (SVG, SR 741.01). |
| ↑47 | Vgl. Art. 2 Abs. 1 des Ordnungsbussengesetzes vom 18. März 2016 (OBG, SR 314.1); kritisch zur Möglichkeit der Sicherstellung und Einziehung nach Art. 8 OBG durch private Sicherheitsdienstleister Mohler, Polizeiberuf, 178 f. |
| ↑48 | Art. 5 Abs. 3 BGST. |
| ↑49 | Art. 22 Abs. 2 BWIS. |
| ↑50 | Art. 3b Abs. 2 Konkordat über Massnahmen gegen Gewalt anlässlich von Sportveranstaltungen (für den Kanton Zürich: Gesetz über den Beitritt zum Konkordat über Massnahmen gegen Gewalt anlässlich von Sportveranstaltungen vom 18. Mai 2009, LS 552.19, Anhang). |
| ↑51 | BGE 127 IV 209 E. 1 S. 210, m.w.H. |
| ↑52 | Vgl. dazu etwa sinngemäss Stratenwerth/Bommer, § 59 Rz. 9. |
| ↑53 | Vgl. etwa § 18 Abs. 2 erster Satz des Gesetzes über die Kantonspolizei des Kantons Solothurn vom 23. September 1990 (PolG/SO; BGS 511.11) mit dem Sachtitel «Uniform/Legitimation», wonach bei Amtshandlungen die Uniform als Ausweis gilt. |
| ↑54 | Siehe die Übertretungstatbestände für das unbefugte Tragen der Polizeiuniform wie §8 Abs. 1 des Gesetzes des Kantons Basel-Landschaft über das kantonale Übertretungsstrafrecht vom 21. April 2005 (ÜStG/BL; SGS 241); Art. 11 Abs. 1 Ziff. 2 des Gesetzes des Kantons Nidwalden über das kantonale Strafrecht vom 29. Juni 2016 (kStG/NW; NG 251.1); Art. 7 Abs. 1 des Gesetzes über die Einführung des Schweizerischen Strafgesetzbuches im Kanton Glarus vom 2. Mai 1965 (EG StGB/GL; GS III E/1) sowie für die Armeeuniform Art. 331 StGB. |
| ↑55 | Häfelin/Müller/Uhlmann, Rz. 1465 ff. «Exekutorische Sanktionen» und insb. Rz. 1478 ff.; Albertini, Art. 23 Rz. 1 ff. |
| ↑56 | CR CP-Postizzi, Art. 312 Rz. 32. Es stellt sich hier die dornenvolle Frage, ab wann ein Handeln auf Befehl von der Strafe befreit; vgl. hierzu generell Art. 20 MStG sowie im Zusammenhang mit dem Völkerstrafrecht Art. 264l StGB. |
| ↑57 | Donatsch/Thommen/Wohlers, 550. |
| ↑58 | BSK StGB-Heimgartner, Art. 312 Rz. 21. |
| ↑59 | BGE 127 IV 209 E. 1.a S. 211 ff.; Urteil des Bundesgerichts 1C_446/2021 vom 24. März 2022 E. 5.3. |
| ↑60 | BSK StPO-Heimberg, Art. 312 Rz. 18; CR CP-Postizzi, Art. 312 Rz. 27; PK StGB-Trechsel/Vest, Art. 312 Rz. 2. |
| ↑61 | Vgl. statt vieler OK BV-Heri, Art. 10 Rz. 86. |
| ↑62 | Sachverhalt gemäss Urteil des Obergerichts des Kantons Bern vom 28. Juni 2016, SK 15 378-380. |
| ↑63 | In aller Regel ist die Zwangsanwendung mit einem Eingriff in Grundrechte verbunden, womit die Voraussetzungen nach Art. 36 BV bzw. der EMRK zu prüfen sind. |
| ↑64 | Polizeibefugnisse sind in aller Regel umfassend in einem Gesetz im formellen Sinne zu erlassen (vgl. statt vieler BGE 128 I 327 E. 4 S. 337 ff.). Prominente Ausnahmen finden sich in der Verordnung über die Polizeibefugnisse der Armee vom 26. Oktober 1994 (VPA, SR 510.32); ablehnend Imhof m.w.H., und den nur teilweise publizierten Verwaltungsvereinbarungen über die sicherheitspolizeilichen Befugnisse des BAZG beispielsweise am Bahnhof Bern (vgl. Art. 97 ZG und im Weiteren Art. 9 AIG). Auch diese Praxis ist klar abzulehnen, können Rechtspflichten – hier die Duldung einer Personenkontrolle durch das BAZG im Landesinneren – gemäss Art. 8 Abs. 1 Publikationsgesetz (PublG, SR 170.512) doch erst mit deren Veröffentlichung und damit deren Vorhersehbarkeit Rechtswirkung entfalten. Ebenso ablehnend Mohler, Grundzüge, 76 und 80, der in dieser Praxis eine Kompetenzverletzung erblickt. |
| ↑65 | Aber BGE 128 I 327 S. 339 E. 4.2: «Für das Polizeirecht stösst das Bestimmtheitserfordernis wegen der Besonderheit des Regelungsbereichs auf besondere Schwierigkeiten», weshalb auch relativ offene Formulierungen genügen; Kritisch SGK BV-Schweizer/Krebs, Art. 36 Rz. 26. |
| ↑66 | BGE 147 I 161 E. 5.1 S. 165 f. |
| ↑67 | Dabei sind an die eingeschränkten Befugnisse von Sicherheitsassistentinnen zu denken. |
| ↑68 | Tiefenthal, 366; wobei es sich beim Warnruf eigentlich um ein milderes Mittel zum Waffeneinsatz handelt, so auch Donatsch/Keller, §17 Rz. 81. |
| ↑69 | Beispielsweise Art. 13 ZAG. |
| ↑70 | Frey/Omlin, 87. |
| ↑71 | Diese können bei der Beurteilung von Sorgfaltspflichten eines mit zu beurteilenden Fahrlässigkeitsdelikts (insb. Art. 117 StGB oder Art. 125 StGB) an Relevanz gewinnen. |
| ↑72 | In die gleiche Richtung: BSK StGB-Heimgartner, Art. 312 Rz. 58; Frey/Omlin, 87. |
| ↑73 | Beispiel von Stratenwerth/Bommer, § 59 Rz. 9. |
| ↑74 | Urteil des Bundesgerichts 6B_391/2013 vom 27. Juni 2013 E. 1.3; so auch die Lehre: Frey/Omlin, 87, BSK StGB-Heimgartner, Art. 312 Rz. 11 f., und CR CP-Postizzi, Art. 312 Rz. 25. |
| ↑75 | Beispiel angelehnt an Pajarola, 264. |
| ↑76 | Urteil des Bundesgerichts 6B_1212/2018 vom 5. Juli 2019 E. 2.4. |
| ↑77 | Kneubuehl et al., 106, 108 und 112. |
| ↑78 | Willmann, 22–27. |
| ↑79 | Statt vieler BGE 142 II 1 E. 2.3 S. 4 f. |
| ↑80 | Bundesgesetz über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe vom 3. Oktober 1951 (BetmG, SR 812.121). |
| ↑81 | Vgl. etwa die Verpflichtung in Art. 136 PolG/BE oder Art. 22 ZAG; zum Hundebiss vgl. Urteil des Bundesgerichts 6B_899/2018 vom 2. November 2018 E. 2.2. |
| ↑82 | BGE 147 I 161 E. 6 S. 168 ff. |
| ↑83 | Urteil des Bundesgerichts 2C_1096/2016 vom 18. Mai 2018 E. 2.4. |
| ↑84 | Vgl. dazu auch Mohler, Grundzüge, 113 m.w.H. |
| ↑85 | Urteil des Bundesgerichts 1C_175/2021 vom 16. Januar 2021 E. 5.2.1. |
| ↑86 | BGer 1C_175/2021 E. 5.2.1; PC CP-Dupuis et al., Art. 312 Rz. 26. |
| ↑87 | BGE 149 IV 128 E. 1.3 S. 131 ff. m.w.H. |
| ↑88 | Stratenwerth/Bommer, § 59 Rz. 12, bemerken zurecht, dass das Absichtserfordernis dem Tatbestand keine schärfere Kontur verleiht; so auch Donatsch/Thommen/Wohlers, 554; kritisch zur bundesgerichtlichen Rechtsprechung Pajarola, 263 f. |
| ↑89 | Botschaft des Bundesrates vom 23. Juli 1918 an die Bundesversammlung zu einem Gesetzesentwurf enthaltend das schweizerische Strafgesetzbuch, BBl 1918 IV 1, 65: «Die Verletzung der allgemeinen Amtspflicht wird hauptsächlich da bedroht, wo sie in einer eigennützigen Ausbeutung der durch das Amt verliehenen Machtbefugnissen besteht». |
| ↑90 | Stratenwerth/Bommer, § 59 Rz. 12. |
| ↑91 | Frey/Omlin, 84. |
| ↑92 | BSK StGB-Heimgartner, Art. 312 Rz. 23; AK StGB-Wyler/Michlig, Art. 312 Rz. 11. |
| ↑93 | BSK StGB-Heimgartner, Art. 312 Rz. 25. |
| ↑94 | BGE 99 IV 13 E. 3 S. 14. |
| ↑95 | BSK StGB-Heimgartner, Art. 312 Rz. 25; PK StGB-Trechsel/Vest, Art. 312 Rz. 10; AK StGB-Wyler/Michlig, Art. 312 Rz. 15; CR CP-Postizzi Art. 312 Rz. 36; PC CP-Dupuis et al., Art. 312 Rz 27; vgl. auch Frey/Omlin, 88. |
| ↑96 | Gemäss PK StGB-Trechsel/Vest, Art. 312 Rz. 10, gilt Alternativität: «bei Amtsmissbrauch geht es um Amtsgewalt, die dem Täter wirklich zusteht, bei Amtsanmassung wird Macht usurpiert»; ebenso CR PC-Postizzi Art. 312 Rz. 35 und CP PC-Dupuis et al., Art. 312 Rz. 28. |
| ↑97 | Beispielsweise im Kanton Zürich, wo Hilfskräfte gemäss ZAG agieren. |
| ↑98 | Vgl. etwa Art. 156 Abs. 1 PolG/BE «Polizeistatus». Gemäss Vortrag des Regierungsrates zum PolG/BE, S. 70 unten, wird mit dem Polizeistatuts die Kompetenz, Zwang anzuwenden, verliehen. |
| ↑99 | Vgl. etwa §5 Abs. 2 Polizeiorganisationsgesetz des Kantons Zürich vom 29. November 2004 (LS 551.1; POG/ZH). |
| ↑100 | Vgl. etwa §18ter Abs. 3 PolG/SO. |
| ↑101 | Komm. PolG-Plüss, Vorbemerkungen zu §§59a–59j Rz. 84 ff. |
| ↑102 | BSK StGB-Heimgartner, Art. 312 Rz. 25 f.; PK StGB-Trechsel/Vest, Art. 312 Rz. 10, m.w.H. und einer differenzierten Übersicht. |
| ↑103 | Frey/Omlin, 88, erblicken in der Praxis gerade die umgekehrte Vorgehensweise. |
| ↑104 | Ebenso die Wahrnehmung von Frey/Omlin, 84, wobei diese Tendenz möglicherweise auf Art. 18 Abs. 2 des Bundesgesetzes über die Verantwortlichkeit des Bundes sowie seiner Behördenmitglieder und Beamten vom 14. März 1958 (VG, SR 170.32) zurückzuführen ist: «Wird neben der Disziplinaruntersuchung wegen der nämlichen Tatsache ein Strafverfahren durchgeführt, so ist in der Regel der Entscheid über die disziplinarische Massnahme bis nach Beendigung des Strafverfahrens auszusetzen». |
| ↑105 | Für Angehörige der Armee hat das Militärkassationsgericht in ständiger Rechtsprechung entschieden, dass eine Disziplinarmassnahme nicht gegen das Doppelbestrafungsverbot verstösst, da diese keine kriminelle Strafe darstellt (MKGE 8 Nr. 56 E. 2 und 4, MKGE 6 Nr. 71 und MKGE 3 Nr. 63). Mit Blick auf die vergleichsweise milden personalrechtlichen Massnahmen für Angehörige der Polizei muss das Gleiche gelten. Vgl. auch BGE 99 IV 13 E. 2. S. 14. |
| ↑106 | Vgl. Flachsmann et al. für Disziplinarmassnahme von Angehörigen der Armee, Rz. 811. |
| ↑107 | BSK StGB-Wiprächtiger/Keller, Art. 47 Rz. 161; ebenso Flachsmann et al., Rz. 196. |
| ↑108 | Für einen generellen Überblick zur Staatshaftung bei polizeilichem Handeln siehe Sutter, passim, Magnin, passim sowie Selle, passim. |
| ↑109 | Vgl. statt vieler BGE 146 IV 76 E. 3.1 S. 82 f. |
| ↑110 | Zur Haftung für rechtmässige Schädigung siehe Gross/Pribnow, 26 f., sowie Jaag, 52 ff. |